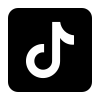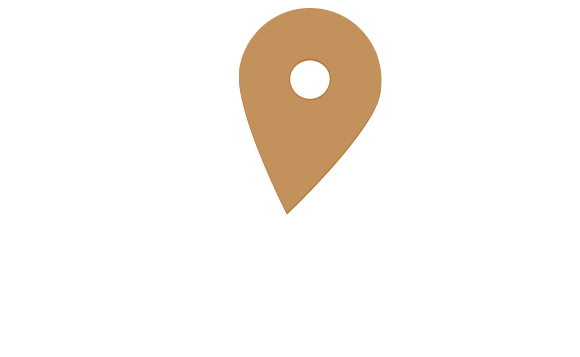Aktenzeichen 12 S 776/17
BGB § 157, § 242, § 309 Nr. 5, § 310 Abs. 4, § 738
HGB § 171
Leitsatz
1. § 691 Abs. 2 ZPO gilt entsprechend, wenn zwischen der Zustellung der Zwischenverfügung (Zugang der Beanstandung) und der Berichtigung (Eingang der fehlenden Angaben usw.) ein Zeitraum von einem Monat liegt. Es erweitert die Bestimmung des § 691 Abs. 2 ZPO die Regelung des § 167 ZPO. Es soll vermieden werden, dass dem Antragsteller durch die Wahl des Mahnverfahrens (statt Klage) Nachteile entstehen, wenn sich die Unzulässigkeit des Mahnverfahrens herausstellt. Die Neuregelung des § 691 Abs. 2 ZPO kann daher dazu führen, dass der Antragsgegner aufgrund des Verfahrens nach § 691 Abs. 2 S. 1 ZPO erst nach einem Zeitraum, der die Monatsfrist deutlich übersteigen kann, erfährt, dass der Gläubiger die Unterbrechung der Verjährung bewirkt hat. (Rn. 34 – 35) (redaktioneller Leitsatz)
2. Ein Beratungsfehler dahingehend, dass zum Zeitpunkt des Beitritts der Hinweis fehlt, dass der Gesellschaftszweck nicht mehr erreicht werden konnte, führt zu einer fehlerhaften Gesellschaft mit dem Recht zur Kündigung. Wird die Kündigung nicht erklärt, sind die Beiträge zu leisten. (Rn. 45) (redaktioneller Leitsatz)
3. Die im Gesellschaftsvertrag festgelegte Abwicklungspauschale stellt keine Schadensersatzforderung im Sinne des § 309 Nr. 5 BGB dar. Die Vertragsklausel hat erkennbar nicht den Fall vor Augen, dass der Gesellschaft durch den Austritt ein bestimmter Schaden entstanden ist. Es ist auch nicht vorstellbar, wie sich ein solcher Schaden errechnen sollte und wie der Gesellschafter den Gegenbeweis nach § 309 Nr. 5 b) BGB führen sollte. Es handelt sich dabei um eine von § 738 BGB abweichende Vereinbarung. Solche Vereinbarungen sind üblich. Sie bezwecken in der Regel eine Vereinfachung der Abrechnung sowie den Schutz der Gesellschaft vor zu hohem Kapitalabfluss. (Rn. 55) (redaktioneller Leitsatz)
Verfahrensgang
7 C 292/16 2017-02-23 Endurteil AGFREISING AG Freising
Tenor
I.
Auf die Berufung der Klägerin wird das Endurteil des Amtsgerichts Freising vom 23.02.2017 wie folgt abgeändert:
1. Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 2.219,96 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit 01.12.2012 aus 1.482,04 EUR und aus 2.219,86 EUR seit 30.12.2015 zu bezahlen.
2. Im übrigen wird die Klage abgewiesen.
3. Von den Kosten des Rechtszugs I. Instanz tragen die Klägerin 22 % und der Beklagte 78 %.
II.
Die weitergehende Berufung der Klägerin wird zurückgewiesen.
III.
Der Beklagte trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.
IV.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
V.
Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 2.219,96 EUR festgesetzt.
VI.
Die Revision wird nicht zugelassen.
Gründe
Die Berufung der Klägerin ist statthaft und zulässig. Sie wurde insbesondere rechtzeitig eingelegt und rechtzeitig begründet.
In der Sache hat das Rechtsmittel im Wesentlichen Erfolg.
1.: Die Kammer geht nach wie vor nicht von einer Verjährung aus. Wie der Beklagte selbst schreibt, handelt es sich bei der Rechtsauffassung des Erstgerichts um eine Mindermeinung. Die auf das Urteil des OLG Dresden vom 28.09.2006 gestützte Rechtsauffassung des Erstgerichts ist der Kammer auch aus einem anderen Verfahren bekannt. Die Kammer teilt die Rechtsauffassung des Amtsgerichts Freising in dieser Hinsicht nicht.
a) Die Ausführungen im Schriftsatz des Beklagten vom 14.07.2017 geben der Kammer keinen Anlass, von ihrer Rechtsauffassung abzuweichen.
Wie bereits im Hinweis dargelegt, endete die reguläre Verjährungsfrist mit Ablauf des Jahres 2015. Der Mahnbescheidsantrag ging am 29.12.2015 beim Mahngericht ein.
Er lautet: „Ausschlusskosten GHP08 Anteil x vom 15.11.12“.
Im Hinblick auf diese Angabe konnte der Beklagte nicht im Zweifel darüber sein, welcher Anspruch gegen ihn geltend gemacht wird, auch wenn das Datum 15.11.12 unrichtig sein sollte und auch wenn der Betrag aus dem Mahnbescheid sich nicht mit der Forderung aus dem Schreiben vom 19.11.2012 deckt.
Der Rechtspfleger beim Mahngericht hat am 04.01.2016 ein Monierungsschreiben veranlasst, da das Vertretungsverhältnis (Abwickler) nicht zur angegebenen Rechtsform der Klägerin (GmbH & Co. KG) passte. Mit Schreiben vom 27.01.2016, Anlage K 9, erfolgte die Berichtigung durch die Klägerin. Am 05.02.2016 ist der Mahnbescheid ergangen. Die Zustellung erfolgte am 09.02.2016.
Die Kammer teilt nicht die Auffassung des Erstgerichts, dass unter diesen Voraussetzungen die Verjährung eingetreten ist. Die Auffassung des Erstgerichts entspricht nicht der Rechtsprechung der Kammer in vergleichbaren Fällen.
Nach wohl völlig überwiegender Meinung gilt § 691 Absatz 2 ZPO entsprechend, wenn zwischen der Zustellung der Zwischenverfügung (Zugang der Beanstandung) und der Berichtigung (Eingang der fehlenden Angaben usw.) ein Zeitraum vom einem Monat liegt (statt vieler: Vollkommer/Zöller, § 691 Rdnr. 4 mit zahlreichen weiteren Nachweisen). Ausweislich der Kommentierung von Hüßtege/Thomas/Putzo, § 691 ZPO Rdnr. 12 und 13 erweitert die Bestimmung des § 691 Absatz 2 ZPO die Regelung des § 167 ZPO. Es soll vermieden werden, dass dem Antragsteller durch die Wahl des Mahnverfahrens (statt Klage) Nachteile entstehen, wenn sich die Unzulässigkeit des Mahnverfahrens herausstellt. Ausweislich der grundlegenden Entscheidung des BGH vom 21.03.2002, Az.: VII ZR 230/01 soll eine Benachteiligung des Antragstellers im Mahnverfahren beseitigt werden. Es soll verhindert werden, dass nach Erhalt einer Zwischenverfügung der Antragsteller von der Berichtigung des Mahnantrags absieht und Klage erhebt. Wie der BGH ausführt, würde dies der Funktion des Mahnverfahrens widersprechen, das dem Gläubiger einer Geldforderung einen einfacheren und billigeren Weg zu einem Vollstreckungsbescheid eröffnen will. Des Weiteren weist der BGH ausdrücklich darauf hin, dass die Neuregelung des § 691 Absatz 2 ZPO dazu führen kann, dass der Antragsgegner aufgrund des Verfahrens nach § 691 Absatz 2 Satz 1 ZPO erst nach einem Zeitraum, der die Monatsfrist deutlich übersteigen kann, erfährt, dass der Gläubiger die Unterbrechung der Verjährung bewirkt hat.
Die Differenzierung danach, ob nach Erlass einer Zwischenverfügung Klage eingereicht wird oder ob der Mahnbescheidsantrag berichtigt wird, entspricht ausgehend von dieser Rechtsprechung nicht dem Gesetzeszweck. Der Antragsteller im Mahnverfahren soll gerade nicht anders gestellt werden als derjenige, der eine Klage anfertigt. Ausgehend hiervon ergibt sich eine Hemmung von einem Monat und 2 Wochen (Thomas/Putzo, a.a.O., Rdnr. 13).
Aus der Entscheidung des OLG Dresden vom 28.09.2006, Az.: 9 U 1869/05, folgt nichts anderes. Die Kammer erachtet diese Entscheidung schon deshalb nicht für maßgeblich, weil es für den Ausgang dieses Verfahrens auf die Verjährungsfrage (eine Verjährung wurde vom OLG nicht angenommen) nicht angekommen ist.
b) Die Kammer kann auch nach wie vor keinen Missbrauch des Mahnverfahrens erkennen. Es ist nach wie vor davon auszugehen, dass die unrichtige Betragsangabe im Mahnbescheid auf einer Nachlässigkeit beruht und ein vorsätzlicher Missbrauch des Mahnverfahrens durch den Abwickler nicht gegeben ist.
Es trifft zu, dass die im Mahnbescheid geltend gemachte Forderung mehr als doppelt so hoch ist wie die berechtigte Forderung und noch wesentlich höher als die dem Beklagten mit der Anlage B 1 am 19.11.2012 in Rechnung gestellte Forderung von 1.482,04 EUR. Ferner ist zutreffend, dass aus der ursprünglichen Anspruchsbegründung sich nicht ansatzweise ergibt, wie sich der geltend gemachte Betrag errechnet und dass die Klägerin zunächst von einer falschen Vertragsfassung ausgegangen ist.
Diese Umstände beweisen allerdings keinen Vorsatz. Es liegt insbesondere kein Fall vor wie in der Entscheidung des BGH vom 23.06.2015, Az.: VI ZR 536/14, kommentiert bei Zöller unter Rdnr. 693, Rdnr. 3 a). Im dortigen Verfahren war unstreitig, dass sich die Antragstellerin vorsätzlich das ungeeignete Mahnverfahren zunutze gemacht hat, um eine Zug um Zug Verurteilung zu unterlaufen.
Im gegenständlichen Verfahren ist das Mahnverfahren das geeignete Verfahren gewesen. Lediglich der geltend gemachte Betrag war wesentlich zu hoch. Für den Beklagten war dies ohne weiteres erkennbar. Der Beklagte wusste, welcher Anspruch gegen ihn geltend gemacht wird. Ihm lag auch das Schreiben aus dem November 2012 vor. Der Beklagte hat gegen den Mahnbescheid auch umgehend Widerspruch eingelegt.
Unter diesen Voraussetzungen ist schon nicht erkennbar, welche Vorteile sich die Klägerin durch die Geltendmachung eines überhöhten Betrags hätte verschaffen können. Der Klägerin kann nicht unterstellt werden, sie hätte willkürlich einen viel zu hohen Betrag eingefordert in der Hoffnung, so zu einem materiell unrichtigen Titel zu Lasten des Beklagten zu kommen. Die diesbezüglichen Ausführungen des Beklagten im Schriftsatz vom 14.07.2017 sind spekulativ. Die Tatsache, dass die ursprünglich geltend gemachte Forderung überhöht und nicht nachvollziehbar war, rechtfertigt nicht den Schluss, es hätte sich um einen Missbrauch des Mahnverfahrens gehandelt.
Soweit der Beklagte vorträgt, die Klägerin wäre in anderen Verfahren entsprechend vorgegangen, wird diese Behauptung nicht näher belegt. Die Urteile, aus denen sich Derartiges ergeben soll, benennt der Beklagte nicht. Die Ausführungen dazu, dass Verbraucher sich häufig gegenüber Mahnbescheiden nicht wehren, sind allgemeiner Natur und belegen keinen Vorsatz der Klägerin im gegenständlichen Verfahren. Entsprechendes gilt in Bezug auf den Hinweis des Beklagten auf missbräuchliche Abmahnwellen im Bereich des Urheberrechts. Dem Urteil des BGH vom 23.06.2015 liegt, wie bereits ausgeführt, ein anderer Sachverhalt zugrunde.
In der Sache ist folgendes auszuführen:
2.: Soweit der Beklagte sich darauf beruft, dass der Gesellschaftszweck zum Zeitpunkt seines Beitritts am 04.10.2010 bereits erkennbar gescheitert war, führt dies nicht dazu, dass der Beklagte nicht verpflichtet war, die vereinbarten Zahlungen zu leisten. Es kann dahinstehen, ob ein Beratungsfehler darin bestanden hat, dass der Beklagte nicht darauf hingewiesen worden ist, dass die Geschäftsleitung bereits Mitte 2010 beabsichtigte, eine Änderung von § 2 des Geselllschaftsvertrags herbeizuführen dahingehend, dass das Fremdkapital nicht mindestens eine 80%ige Kapitalgarantie aufweisen muss.
Ein etwaiger Beratungsfehler in diesem Zusammenhang hätte zu einer fehlerhaften Gesellschaft geführt mit dem Recht zur Kündigung. Eine Kündigung hat der Beklagte nicht erklärt. Er hat seinen Beitritt auch nicht angefochten. Er hat einfach die Zahlungen eingestellt. Ausweislich Palandt, § 705 Rdnr. 18 b) ist die fehlerhafte Gesellschaft nicht von Anfang an unwirksam und die Gesellschafter sind im Innenverhältnis zur Leistung der vereinbarten Beiträge verpflichtet.
Es kommt hinzu, dass der maßgebliche Gesellschaftsvertrag im Hinblick auf die im Juni 2011 durchgeführte Änderung des Vertrags in § 31 ausdrücklich ein Sonderaustrittsrecht bestimmt.
Dieses wurde vom Beklagten nicht ausgeübt. Auch hat der Beklagte nicht von seinem Recht Gebrauch gemacht, gemäß § 16 des Treuhandvertrags diesen ordentlich oder fristlos außerordentlich zu kündigen.
Der Beklagte war deshalb verpflichtet, die vereinbarten Zahlungen zu leisten. Auch etwaige Beratungsfehler Dritte (Vermittler oder Anlageberater) führen zu keiner anderen Beurteilung. Insofern wird auf die von der Klagepartei vorgelegten Urteile, zuletzt das Urteil des Landgerichts Hanau vom 15.12.2016, Bezug genommen.
3.: Was die Regelungen betreffend die Allgemeinen Geschäftsbedingungen anbelangt, so handelt es sich um einen Gesellschaftsvertrag, für den gemäß § 310 Absatz 4 BGB die Vorschriften der §§ 305 ff. BGB jedenfalls nicht unmittelbar gelten. Der Hinweis des Beklagten auf die Entscheidung des BGH vom 16.03.2017, ZR 489/16, verfängt nicht. Im dortigen Fall ging es um einen AGB vertraglichen Ausschluss der Haftung des Treuhandkommandititsten für vorvertragliches Beratungsverschulden. Vorliegend handelt es sich demgegenüber um einen Streit zwischen Gesellschaft und Publikumsgesellschafter betreffend dessen Abfindungsguthaben. Die Kammer verkennt auch nicht, dass nach der Rechtsprechung des BGH bei Gesellschaftsverträgen von Publikumgesellschaften eine ähnliche Auslegung und Inhaltskontrolle (gemäß § 242 BGB) wie bei Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Betracht kommt (so auch die vom Beklagten zitierte Entscheidung des BGH vom 22.09.2015, Az.: II ZR 310/14). Diese Entscheidung sagt, wie bereits dargelegt, nichts Neues aus, sondern bekräftigt lediglich die ständige Rechtsprechung des BGH beginnend mit dem Urteil vom 27.11.2000, II ZR 218/00. Dementsprechend führt der BGH in seinem Beschluss vom 22.09.2015, Az.: II ZR 310/14, aus, dass die Grundsätze, nach denen die von einem Unternehmen für eine Vielzahl von Gesellschaftsverträgen mit stillen Gesellschaftern vorformulierten Vertragsbedingungen auszulegen sind, in der Rechtsprechung des Senats seit langem geklärt sind. Änderungen an dieser Rechtsprechung haben sich nicht ergeben. Dies ist letztlich auch ein Grund, warum vorliegend die Revision nicht zugelassen werden muss.
Nach der Entscheidung des BGH vom 27.11.2000 unterliegen die von einem Unternehmen für eine Vielzahl von Gesellschaftsverträgen mit stillen Gesellschaftern vorformulierten Vertragsbedingungen einer ähnlichen objektiven Auslegung und Inhaltskontrolle wie Allgemeine Geschäftsbedingungen gemäß §§ 157, 242 BGB. Hiervon geht die Kammer aus. Auf den nunmehrigen Einwand, das OLG Karlsruhe hätte am 28.02.2013 ebenso wie das Landgericht Hanau in seinem Urteil vom 15.12.2016 falsch entschieden, weil sie sich nicht mit der AGB-Rechtsprechung befasst haben, kommt es deshalb nicht. Soweit der Beklagte erneut darauf hinweist, dass der BGH die Grundsätze der Regelungen betreffend Allgemeine Geschäftsbedingungen im Bereich von Publikumsgesellschaften für anwendbar erachtet, trifft dies zu mit der Modifikation, dass eine Inhaltskontrolle ähnlich wie bei AGB durchzuführen ist.
4.: Die Kammer vermag nach wie vor keine treuwidrige Benachteiligung des Beklagten durch die gesellschaftsvertraglichen Regelungen erkennen, auch wenn an diese Regelungen ähnliche Maßstäbe angelegt werden wie an Allgemeine Geschäftsbedingungen. Daran ändert nichts der Umstand, dass mehrere Amtsgerichte (Anlagen BB 1 ff.) die Sache anders beurteilt haben. Der Hinweis des Beklagten, das Oberlandesgericht Karlsruhe hätte in Kenntnis der Rechtsprechung des BGH vermutlich anders entschieden, ist spekulativ. Das AG Lingen wendet die §§ 307 ff. BGB strikt an, ohne die Frage der Bereichsausnahme vertieft zu diskutieren. Was die im Urteil des Amtsgerichts Frankfurt am Main wiedergegebene Entscheidung des LG Stuttgart anbelangt, so hat dieses „in Anlehnung an die Wertung des § 309 Nr. 5 bzw. Nr. 6“ eine unangemessene Benachteiligung erkannt, weil dem Anleger der Nachweis eines geringeren Schadens nicht eröffnet worden ist.
Die Kammer teilt diese Einschätzung, wie bereits in ihrem Hinweis mitgeteilt, nicht. Es handelt nicht um einen Schadensersatzanspruch.
Soweit das Amtsgericht Offenbach in seinem Urteil vom 08.05.2017 und das Amtsgericht Bremen im Urteil vom 04.04.2017 von einer Unwirksamkeit nach § 242 BGB ausgehen, werden auch diese Auffassungen von der Kammer nicht geteilt. Die Kammer ist auch nicht verpflichtet, den beiden Amtsgerichten zu folgen.
5.: Was die Mehrwertsteuer anbelangt, so bleibt die Kammer dabei, dass die vertragliche Regelung eindeutig ist. Sie ist auch nicht überraschend. Es ist davon auszugehen, dass ein Gesellschafter, der sich dafür entscheidet, seine Zahlungsverpflichtungen nicht mehr zu erfüllen, unschwer erkennen kann, dass dies möglicherweise die Geltendmachung von Ansprüchen durch die Gesellschaft nach sich ziehen wird. Einem solchen Gesellschafter empfiehlt sich in einem derartigen Fall dringend die Lektüre des Gesellschaftsvertrags. Dort kann ohne weiteres nachgelesen und ersehen werden, wie sich die Abwicklungspauschale errechnet.
6.: Die Kammer vermag in der Abwicklungspauschale auch keine Schadensersatzforderung im Sinn des § 309 Nr. 5 BGB zu erkennen. Die Vertragsklausel hat erkennbar nicht den Fall vor Augen, dass der Gesellschaft durch den Austritt ein bestimmter Schaden entstanden ist. Es ist auch nicht vorstellbar, wie sich ein solcher Schaden errechnen sollte und wie der Gesellschafter den Gegenbeweis nach § 309 Nr. 5 b) BGB führen sollte. § 25 des maßgeblichen Gesellschaftsvertrags regelt keinen Schadensersatzanspruch, sondern eine Abfindung. Es handelt sich dabei um eine von § 738 BGB abweichende Vereinbarung. Solche Vereinbarungen sind üblich. Sie bezwecken in der Regel eine Vereinfachung der Abrechnung sowie den Schutz der Gesellschaft vor zu hohem Kapitalabfluss (Palandt, § 738 Rdnr. 7). Auch bei wirtschaftlich tätigen Gesellschaften sind solche Beschränkungen grundsätzlich zulässig, unterliegen allerdings der Kontrolle im Rahmen des § 138 BGB, vorliegend auch des § 242 BGB. Nicht zulässig sind willkürliche oder zum Interesse am Fortbestand der Gesellschaft außer Verhältnis stehende Beschränkungen. Eine derartige willkürliche oder unverhältnismäßige Beschränkung kann die Kammer nicht erkennen. § 25 Absatz 5 des Gesellschaftsvertrags sieht den Anfall der 11%igen Pauschale für den Fall vor, dass dem Gesellschafter aus wichtigem Grund gekündigt wird. Dies ist dann der Fall, wenn dieser seine Zahlungsverpflichtungen einstellt (§ 23 Absatz 1 b) des Gesellschaftsvertrags). Die Fälligkeit von Zahlungen regelt sich in § 8 des Vertrags. Absatz 4 dieses Paragraphen sieht vor, dass der Gesellschafter zunächst zur Zahlung aufgefordert wird. Kommt der Gesellschafter gleichwohl seinen Verpflichtungen nicht nach, ist die Abwicklungspauschale geschuldet. Eine gegen Treu und Glauben verstoßende Regelung kann die Kammer hier nicht erkennen. Auch geht es nicht um einen konkreten Schaden der Gesellschaft, sondern um den Schutz vor zu hohem Kapitalabfluss.
Eine am Markt agierende Gesellschaft hat ein erhebliches Interesse daran, dass die Gesellschafter ihre Beiträge wie vereinbart bezahlen. Eine derartige Gesellschaft muss kalkulieren. Von einer solchen Gesellschaft kann nicht verlangt werden, dass sie Zahlungseinstellungen der Gesellschafter einfach akzeptiert. Es kann auch nicht verlangt werden, dass die Gesellschaft in einen Streit mit dem Gesellschafter eintritt über die Frage, ob und in welchem Umfang Anlegerkapital benötigt wird zur Durchführung von Investitionen. Die Gesellschaft muss planen. Dies hat mit einem Schaden im engeren Sinn nichts zu tun. Die Vorschriften betreffend den Schadenersatz in Allgemeinen Geschäftsbedingungen gehen auch davon aus, dass der Geschädigte nicht am Schaden verdienen soll. Der vorliegende Fall ist damit nicht ohne weiteres vergleichbar. Es handelt sich um eine im Gesellschaftsrecht durchaus übliche Abfindungsklausel, die aus den vorgenannten Gründen auch unter Berücksichtigung ihrer Höhe nicht als unangemessen nachteilig angesehen werden kann. Insbesondere gilt dies auch vor dem Hintergrund, dass dem Beklagten mit Änderung des Gesellschaftsvertrags in § 31 ein Austrittsrecht zuerkannt worden ist, von dem er keinen Gebrauch gemacht hat.
7.: Auf die Ausführungen zum Provisionsanspruch der C. Vertriebsgesellschaft kommt es bei der an den §§ 157, 242 BGB orientierten objektiven Auslegung und Inhaltskontrolle (BGH vom 27.11.2000, a.a.O.) nicht an.
Soweit der Beklagte in seinem Schriftsatz vom 14.07.2017 erstmalig darauf hinweist, er sei der Gesellschaft gar nicht beigetreten, so steht dies in Widerspruch zu den Ausführungen in der Klageerwiderung, wo unstreitig gestellt wurde, dass sich der Beklagte mit 72.000,- EUR zuzüglich 3.600,- EUR Agio beteiligt hat.
Unabhängig davon hat sich der Beklagte tatsächlich an der Klägerin beteiligt und 2 Jahre lang Einzahlungen geleistet. Er wurde als Gesellschafter geführt. Die streng formal juristischen Ausführungen der Amtsgerichte Bremen und Offenbach erachtet die Kammer vor diesem Hintergrund nicht für überzeugend. Würde man dem folgen, müsste der Beklagte selbst nach Ablauf der dreißigjährigen Spardauer als Nichtgesellschafter angesehen werden und es hätte eine Rückabwicklung nach Bereicherungsrecht zu erfolgen. Eine derartige bereicherungsrechtliche Rückabwicklung kommt nach Invollzugsetzung der Gesellschaft nicht in Betracht, zumal der Gesellschaftsvertrag über 2 Jahre hinweg gelebt worden ist.
8.: Die Forderung ist von der Klagepartei nachvollziehbar berechnet worden. Es ist insbesondere unstreitig, dass zur Anlagesumme von 72.000,- EUR das Agio noch dazukommt. Soweit der Beklagte erstinstanzlich die Berechnung der Forderung bestritten hat, erfolgte dieses Bestreiten pauschal. Für die Kammer ist nicht ersichtlich, was an der Berechnung falsch sein soll.
9.: Was die geltend gemachten Verzugszinsen anbelangt, so wurden Zinsen zugesprochen ab dem 01.12.2012 aus dem zu diesem Zeitpunkt geltend gemachten Zahlbetrag. Zinsen aus dem höheren Betrag konnten erst ab Eingang des Mahnantrags beim Mahngericht zugesprochen werden.
10.: Bei der Entscheidung betreffend die Kosten der I. Instanz hat die Kammer berücksichtigt, dass bei Geltendmachung der berechtigten Forderung angefallen wären 2 x eine 1,2 Termisgebühr und 2 x eine 1,3 Verfahrensgebühr (insgesamt: 1.005,- EUR) sowie 324,- EUR an Gerichtskosten (insgesamt 1329- EUR).
Dadurch, dass eine überhöhte Forderung geltend gemacht worden ist, sind tatsächlich Kosten in Höhe von insgesamt 1.708,20 EUR entstanden (Gerichtskosten: 438,- EUR sowie 2 x eine 1,3 Gebühr von 393,90 EUR sowie 2 x eine 1,2 Gebühr von 241,20 EUR). Diese Mehrkosten sind der Klagepartei aufzuerlegen. Die Kammer hat dem Rechnung getragen, indem sie das Verhältnis der Beträge von 1.708,20 EUR und von 1.329,- EUR ins Verhältnis gesetzt hat, was die Quote von 78 : 22 ergibt.
Die Kosten des Berufungsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10, 713 ZPO.
11.: Die Revision war nicht zuzulassen. Die Sache hat keine grundsätzliche Bedeutung. Die hier angesprochenen Rechtsfragen sind höchstrichterlich geklärt (vgl. Urteil des BGH vom 22.09.2015, a.a.O.). Auch gebietet die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung nicht die Zulassung der Revision. Selbst die Abweichung von Berufungsgerichten untereinander begründet für sich gesehen noch keine grundsätzliche Bedeutung der Sache (Zöller, § 543 Rdnr. 11). Abgesehen davon trägt der Beklagte auch nicht vor, welche oberlandesgerichtlichen Entscheidungen von der Rechtsauffassung der Kammer abweichen. Die einzige hier bekannte Entscheidung eines Oberlandesgerichts ist die des OLG Karlsruhe, die im Ergebnis mit der Rechtsauffassung dieser Kammer übereinstimmt und die der Beklagte für falsch hält. Soweit vom Beklagten ein Urteil des OLG Frankfurt am Main vom 13.02.2015, Az.: 4 U 221/14 zitiert wird, befasst sich dieses mit der Haftung einer Gründungskommanditistin für Aufklärungsfehler im Rahmen des Vertriebs. Um Fragen betreffend Allgemeine Geschäftsbedingungen geht in dieser Entscheidung nicht.