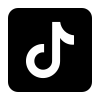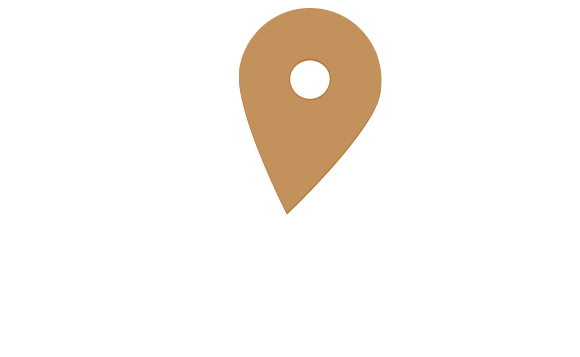Aktenzeichen M 16 K 15.5333
VwGO § 113 Abs. 1 S. 1
Leitsatz
1. Die Aufsicht des Deutschen Patent- und Markenamtes über die Verwertungsgesellschaften beschränkt sich im Rahmen der Überprüfung von Nutzungsbedingungen und entsprechenden Tarifen auf eine Evidenzkontrolle. Aufsichtsmaßnahmen dürfen nur ergriffen werden, wenn Nutzungsbedingungen grob unangemessen sind. (amtlicher Leitsatz)
2. Im Bereich der Verwertungsrechte kann nicht ohne belastbare Tatsachengrundlage unterstellt werden, dass bei Abschluss eines Vertrags, in dem von Rechteinhabern ausdrücklich oder konkludent bestätigt wird, die zu übertragenden Rechte innezuhaben, vertragswidrig bereits zuvor prioritär über diese Rechte verfügt wurde. (amtlicher Leitsatz)
Tenor
I.
Der Bescheid der Beklagten vom … März 2015 und der Widerspruchsbescheid vom … Oktober 2015 werden aufgehoben.
II.
Die Beklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.
III.
Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar.
Die Beklagte darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe des vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht die Klägerin vorher Sicherheit in Höhe des jeweils zu vollstreckenden Betrags leistet.
Gründe
Die zulässige Klage ist begründet. Der Bescheid vom … März 2015 und der Widerspruchsbescheid vom … Oktober 2015 sind rechtswidrig und verletzen die Klägerin in ihren Rechten, § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO.
A. Rechtsgrundlage des angegriffenen Bescheids ist § 19 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 UrhWahrnG in Verbindung mit § 11 Abs. 1 UrhWahrnG. Nach § 19 Abs.1 UrhWahrnG hat die Aufsichtsbehörde – das Deutsche Patent- und Markenamt – darauf zu achten, dass die Verwertungsgesellschaft den ihr nach diesem Gesetz obliegenden Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. § 19 Abs. 2 Satz 2 UrhWahrnG ermächtigt die Aufsichtsbehörde nach eigenem Ermessen alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass eine Verwertungsgesellschaft die ihr obliegenden Verpflichtungen ordnungsgemäß erfüllt. Nach § 11 Abs. 1 UrhWahrnG ist eine Verwertungsgesellschaft verpflichtet, aufgrund der von ihr wahrgenommenen Rechte jedermann auf Verlangen zu angemessenen Bedingungen Rechte einzuräumen.
Maßgeblicher Zeitpunkt für die gerichtliche Beurteilung der Rechtswidrigkeit des streitgegenständlichen Bescheids ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der letzten Behördenentscheidung, mithin der Erlass des Widerspruchsbescheids. Von diesem für Anfechtungsklagen geltenden Grundsatz ist vorliegend nicht abzuweichen, zumal die Ermächtigungsgrundlage für den Erlass des Bescheids der Beklagten Ermessen einräumt (vgl. BVerwG, B. v. 27.12.1994 – 11 B 152/94 – juris). Änderungen der Sach- und Rechtslage nach diesem Zeitpunkt sind daher für das gerichtliche Verfahren unbeachtlich. Rechtsgrundlage für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit des Bescheids sind die zum Zeitpunkt des Erlasses des Widerspruchsbescheids geltenden rechtlichen Vorgaben, insbesondere das Urheberrechtswahrnehmungsgesetz. Dessen Nachfolger, das Verwertungsgesellschaftengesetz (VGG), trat erst am 1. Juni 2016 in Kraft (Art. 7 VG-Richtlinie-Umsetzungsgesetz, BGBl I 2016, 1190, 1216) und ist nicht heranzuziehen, da der Widerspruchsbescheid bereits im Jahr 2015 erlassen wurde.
I. Die dem Bescheid zugrunde liegenden und von der Beklagten vorgetragenen Tatsachen und Indizien tragen die gesetzlichen Voraussetzungen der Rechtsgrundlage des § 19 Abs.1 und Abs. 2 Satz 2 UrhWahrnG in Verbindung mit § 11 Abs. 1 UrhWahrnG nicht. Der streitgegenständliche Tarif und damit die von der Klägerin aufgestellten Nutzungsbedingen sind nicht als grob unangemessen anzusehen, § 11 Abs. 1 UrhWahrnG. Der streitgegenständliche Bescheid und der Widerspruchsbescheid sind bereits deshalb materiell rechtswidrig.
1. Die Kontrolle von Nutzungsbedingungen bzw. Tarifen durch die Beklagte beschränkt sich nach Auffassung des Gerichts nur auf eine Kontrolle der groben Unangemessenheit von Nutzungsbedingungen.
a. Auch die Kommentarliteratur geht mehrheitlich von einer eingeschränkten Angemessenheitskontrolle aus (Freudenberg in Ahlberg/Götting, Beck’scher Onlinekommentar Urheberrecht, § 13 UrhWahrnG, Rn. 23 und § 18 UrhWahrnG, Rn. 3; Gerlach in Wandtke/Bullinger, Praxiskommentar zum Urheberrecht, 4. Aufl. 2014, § 18 Rn. 2; Reinbothe in Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, § 11, Rn. 11; Schulze in Schulze/Dreier, Urheberrechtsgesetz, UrhWahrnG, 4. Auflage 2013, § 13, Rn. 44; Freudenberg in Möhring/Nicolini, Urheberrecht, 3. Auflage 2014, UrhWahrnG, § 11 Rn. 10). Rechtsprechung zu dieser Frage existiert – soweit ersichtlich – nicht.
b. Für diese Ansicht spricht die gesetzlich zwingend vorgesehene Einrichtung einer spezialisierten Schiedsstelle (§§ 14 ff. UrhWahrnG /§§ 92 ff. VGG). Diese Entscheidung des Gesetzgebers zeigt, dass sich vorrangig dieses Gremium mit Fragen der Angemessenheit von Tarifen beschäftigen soll. Die Schiedsstelle befasst sich – nach übereinstimmendem Vortrag der Beteiligten – zudem auch tatsächlich umfassend mit der Frage der Angemessenheit von Tarifen. Sie und der nachfolgende Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten sind daher primär dazu berufen, Fragen der Angemessenheit von Tarifen zu beurteilen.
c. Für eine zurückgenommene Aufsicht spricht auch die Gesetzesbegründung des Verwertungsgesellschaftengesetzes aus dem Jahre 1962 (BT – Drs. IV/271), dem Vorgänger des späteren Urheberrechtswahrnehmungsgesetzes. Dort heißt es unter anderem (BT – Drs. IV/271, S. 12): „Der Inhalt der im Entwurf vorgesehenen Aufsicht ist im Wesentlichen auf das Recht, Auskunft über alle die Geschäftsführung betreffenden Angelegenheiten zu verlangen, Einsicht in die Geschäftsbücher zu nehmen und einen Beauftragten zu den Sitzungen bestimmter Gesellschaftsorgane zu entsenden, beschränkt. Dieses Recht wird ergänzt durch gewisse Unterrichtungspflichten der Verwertungsgesellschaften.“ Von einer umfassenden Überprüfung von Tarifen hingegen ist in der Gesetzesbegründung nicht die Rede. An anderer Stelle wird die Gesetzesbegründung noch deutlicher: „§ 19 Abs. 1 beschränkt den Umfang der Aufsicht auf eine allgemeine Überwachungspflicht der Aufsichtsbehörde“ (BT – Drs. IV/271, S. 20).
d. Auch in der Begründung des Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet des Urheberrechts wird angedeutet, dass die Tarifprüfung der Staatsaufsicht durch das Deutsche Patent- und Markenamt schon aus tatsächlichen Gründen auf eine Evidenzkontrolle beschränkt ist. Dort findet sich Folgendes in der Begründung: „ […] die Zuständigkeit der Schiedsstelle auf Streitigkeiten zwischen Verwertungsgesellschaften und Einzelnutzer zu erweitern. […] Die Erweiterung der Zuständigkeit dient in erster Linie dem Ziel, eine einheitliche und sachkundige Beurteilung der von der Verwertungsgesellschaft aufgestellten Tarife zu ermöglichen. Zwar kann das Deutsche Patentamt als Aufsichtsbehörde schon nach geltendem Recht unangemessene Tarife beanstanden; eine abstrakte Überprüfung der teilweise äußerst komplexen Tarifwerke ist dem Patentamt jedoch kaum möglich, weil sich die Anhaltspunkte für die Beurteilung der Angemessenheit in der Regel erst aus dem konkreten Sachverhalt ergeben, auf den ein bestimmter Tarif angewandt werden soll.“ (BT- Drs. 10/837, S. 12).
e. Im Schlussbericht der Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ klingt zwar an, dass die Staatsaufsicht durch das Deutsche Patent- und Markenamt weitergehend sein könnte (BT – Drs. 16/7000, S. 283 f.). Jedoch handelt es sich insoweit nur um eine Empfehlung. Daran anschließend hat sich die Gesetzeslage nicht geändert und auch in der Begründung zum neuen Verwertungsgesellschaftengesetz wurde diese Empfehlung nicht aufgegriffen. Die Begründung des neuen Verwertungsgesellschaftengesetzes spricht lediglich davon, dass die Aufsicht sich wie bisher auf sämtliche Verpflichtungen der Verwertungsgesellschaften erstreckt. Zur Prüfungsdichte hinsichtlich der Angemessenheit von Tarifen verliert die Begründung kein Wort (BT – Drs. 18/7223, S. 94).
f. Auch wenn Schiedssprüche der spezialisierten Schiedsstelle (§§ 14 ff. UrhWahrnG /§§ 92 ff. VGG) nur inter partes wirken, haben sie Signalwirkung für andere Nutzer urheberrechtlich geschützter Werke und für deren Vereinbarungen mit der betreffenden Verwertungsgesellschaft (so auch BT – Drs. 10/837, S. 12). Dies spricht dafür, dass es einer umfassenden Angemessenheitskontrolle durch die Beklagte nicht bedarf. Der Schutz von Nutzern, die eine Einleitung eines Schiedsstellenverfahrens gegen aus ihrer Sicht überhöhte Tarife aus finanziellen Gründen scheuen, wird durch eine Evidenzkontrolle durch die Staatsaufsicht sichergestellt, da grob unangemessene Tarife durch diese beanstandet werden können. Dadurch kann der Monopolstellung der Verwertungsgesellschaften ausreichend begegnet werden.
2. Der Wiedergabetarif ist jedenfalls nicht grob unangemessen. Der Vortrag und die von der Beklagten ermittelten Indizien können eine grobe Unangemessenheit des Tarifs nicht begründen.
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs richtet sich die Frage, ob eine Vergütung angemessen ist, grundsätzlich nach dem Verhältnis von Leistung und Gegenleistung. Berechnungsgrundlage für die Tarife sollen nach § 13 Abs. 3 Satz 1 UrhWahrnG in der Regel die geldwerten Vorteile sein, die durch die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Werke oder Leistungen erzielt werden. Damit gelte auch für die Vergütungshöhe der urheberrechtliche Beteiligungsgrundsatz, nach dem der Urheber oder Leistungsschutzberechtigte an jeder wirtschaftlichen Nutzung seiner Werke oder Leistungen tunlichst angemessen zu beteiligen sei (vgl. etwa BGH, U. v. 27.10.2011 – I ZR 125/10 – juris Rn. 20). Grundvoraussetzung für die Angemessenheit der Nutzungsbedingung ist mithin das Verhältnis von Leistung und Gegenleistung. Eine Vergütung kann nur im Verhältnis zu den eingeräumten Rechten als angemessen oder unangemessen beurteilt werden.
3. Die Beklagte trägt lediglich Indizien und Vermutungen vor, aus denen sich eine Unangemessenheit des Wiedergabetarifs ergeben soll. Die Beklagte behauptet, dass die Klägerin keine hinreichenden Informationen darüber habe, in welchem Umfang sie über prioritär eingeräumte Rechte verfüge. Dies sei ein ausreichendes Indiz für die Unangemessenheit des Tarifs. Wer den Umfang der ihm zur Wahrnehmung eingeräumten Rechte nicht kenne, könne keinen angemessen Tarif festlegen.
Der Beklagten ist insoweit Recht zu geben, als dass die Klägerin ihrem Tarif nur die ihr prioritär eingeräumten Rechte zugrunde legen kann. Da ein gutgläubiger Erwerb von (Nutzungs-)Rechten nicht möglich ist, ist die Kollision von Rechtsverfügungen über das Prioritätsprinzip zu lösen. Bei doppelter Einräumung von Rechten ist der zeitlich erste Erwerbsakt wirksam. Der Behauptung, die Klägerin habe keinerlei Kenntnis über den ihr eingeräumten Rechtebestand, liegt jedoch die fehlerhafte Annahme der Beklagten zugrunde, dass eine Verwertungsgesellschaft ohne weiteren Anlass aktiv überprüfen müsse, ob ihr alle zur Wahrnehmung eingeräumten Rechte prioritär übertragen worden sind. Darüber hinaus unterstellt die Beklagte ohne belastbare Nachweise, dass für Sendeunternehmen tätige Urheber sowie die Wahrnehmungsberechtigten der Klägerin in großem Stil wahrheitswidrig vorgeben, Rechte zu übertragen, ohne über diese wegen einer prioritären Einräumung an andere Verwertungsgesellschaften verfügen zu können.
a. Nach dem Vortrag der Klägerin sind ihr die in Rede stehenden Rechte durch die mit ihren Wahrnehmungsberechtigten (privaten Sendeunternehmen des Fernsehens und Hörfunks) abgeschlossenen Verträge eingeräumt worden. Die Inhaberschaft der Sendeunternehmen an diesen Rechten sei durch die Wahrnehmungsberechtigten mit Abschluss des Wahrnehmungsvertrags ausdrücklich bestätigt worden. Diesen Vortrag der Klägerin bestreitet die Beklagte nicht, auch das Gericht bezweifelt diese Angabe nicht.
b. Die Klägerin hat bereits vor Erlass des streitgegenständlichen Bescheids gegenüber der Beklagten angegeben, welche abgeleiteten Rechte, die dem Wiedergabetarif zugrunde liegen, sie innehabe. Im Bereich des Hörfunks verfüge sie über abgeleitete Rechte für mindestens 27 Prozent der Gesamtsendezeit mit einer Rechtedichte von 80 Prozent bei Angestellten und 69 Prozent bei freien Mitarbeitern. Im Bereich des Fernsehens liege der Anteil am Gesamtprogramm, an welchem die Klägerin Rechte halte, bei 32 Prozent mit einer Rechtedichte von 93 Prozent bei Angestellten und von 85 Prozent bei freien Mitarbeitern.
c. Die Beklagte bezweifelt vor allem die Angabe der Rechtedichte der Klägerin und geht aufgrund ihrer Ermittlungen davon aus, dass der Klägerin in vielen Fällen Rechte nicht prioritär eingeräumt wurden. Die Ermittlungen der Beklagten tragen diese Zweifel jedoch nicht. Die Behauptung, dass Urheber, die für die Wahrnehmungsberechtigten der Klägerin tätig werden, ihre Rechte vielfach prioritär bereits an eine andere Verwertungsgesellschaft übertragen hätten, entbehrt jeglicher belastbarer Tatsachengrundlage.
aa. Die im Rahmen der Ermittlungen der Beklagten erhobene Zahl der Wahrnehmungsberechtigten und die vermeintliche Zahl von 3.246 Urhebern, die bei den Wahrnehmungsberechtigten der Klägerin als Arbeitnehmer oder freie Mitarbeiter angestellt und zugleich Mitglied in einer anderen Verwertungsgesellschaft im Bereich Sprachwerke seien, erlaubt keine Rückschlüsse auf die prioritäre Einräumung von Rechten zugunsten der anderen Verwertungsgesellschaft. Diese Angabe stammt von einer Verwertungsgesellschaft, die ebenfalls Rechte an Sprachwerken wahrnimmt, einen eigenen Wiedergabetarif am Markt etabliert hat und somit in Konkurrenz zur Klägerin steht. Daher kann nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass die Angaben dieser Verwertungsgesellschaft gegenüber der Beklagten belastbar sind.
Letztlich hängt der Erwerb der Rechte davon ab, zu wessen Gunsten der Urheber am Anfang der Rechtekette zuerst verfügt hat. Belastbare statistische Zahlenangaben oder andere Quellen für die Annahme, dass Urheber regelmäßig oder in großen Teilen prioritär zugunsten einer Verwertungsgesellschaft über ihr Recht verfügen, vermag die Beklagte nicht benennen. Auch dem Gericht sind solche Quellen nicht bekannt. Die Äußerungen der Autoren der von der Klägerin in Auftrag gegebenen Rechtsgutachten, wonach Urheber nicht selten Mitglied in einer Verwertungsgesellschaft seien, sind ebenfalls nicht mit Fundstellen versehen, entbehren also gleichwohl jeder nachweisbarer Tatsachengrundlage.
Selbst wenn davon ausgegangen würde, dass Urheber, die für die Wahrnehmungsberechtigten der Klägerin tätig werden, Rechte prioritär einer Verwertungsgesellschaft eingeräumt hätten, ist damit noch nicht geklärt, ob diese Rechteübertragung umfassend für alle Werke dieser Urheber und ausschließlich für alle näher bestimmten Nutzungen erfolgt wäre. Verwertungsgesellschaften räumen ihren Wahrnehmungsberechtigten grundsätzlich die Möglichkeit ein, die Rechtewahrnehmung auf einzelne Rechte und Ansprüche zu beschränken. Es wäre also möglich, dass die Wahrnehmungsberechtigten der Klägerin trotz der Mitgliedschaft eines für sie tätigen Urhebers in einer Verwertungsgesellschaft gleichwohl Rechte erlangt hätten. Auch in diesem Zusammenhang sind dem Gericht keine Quellen bekannt, aus denen hervorgeht, inwieweit Urheber mit Rücksicht auf ihre Tätigkeit bei einem Wahrnehmungsberechtigten der Klägerin Beschränkungen der Übertragung von Rechten an andere Verwertungsgesellschaften vereinbaren. Hinzu kommt, dass ein Urheber, der beispielsweise als Hobbymusiker Mitglied bei der Verwertungsgesellschaft GEMA ist, gleichwohl noch über andere Rechte verfügen kann, da das Standardmuster des Wahrnehmungsvertrags der GEMA („Berechtigungsvertrag”) gerade nicht alle denkbaren Rechte jeglicher Werke der Kunst umfasst, sondern vor allem auf Tonkunst bezogen ist. Dementsprechend gab etwa ein Wahrnehmungsberechtigter der Klägerin an, dass ein Mitarbeiter einen Berechtigungsvertrag mit der GEMA geschlossen habe, aber als Moderator angestellt sei.
bb. Der Rücklauf auf die Umfrage im Dezember 2012 ist ebenfalls nicht geeignet die Annahme zu begründen, dass die für die Wahrnehmungsberechtigten der Klägerin tätigen Urheber ihre Rechte regelmäßig prioritär an eine Verwertungsgesellschaft abtreten. Zuzustimmen ist der Beklagten in diesem Zusammenhang zwar insoweit, als sich eine Hochrechnung aus den äußerst dürftigen Rückläufen verbietet. Geantwortet haben nur sehr kleine Sendeunternehmen, während die großen Marktteilnehmer des privaten Rundfunks keine umfassende Antwort abgegeben haben. Aus der weitgehenden Nichtbeantwortung der Frage nach der Mitgliedschaft von Urhebern in anderen Verwertungsgesellschaften lassen sich jedoch keine Schlüsse zulasten der Klägerin ziehen. Den Grund für den mangelnden Rücklauf kennen weder die Beklagte noch das Gericht. Es gibt auch keinen Erfahrungssatz, der dafür spricht, dass die Wahrnehmungsberechtigten der Klägerin keine diesbezügliche Kenntnis haben oder verdecken wollen, dass sie nur in geringem Umfang Rechte erworben haben. Aber selbst wenn die Wahrnehmungsberechtigten die Frage nach der Mitgliedschaft ihrer Urheber in einer anderen Verwertungsgesellschaft beantwortet hätten, wäre damit die Frage nach der prioritären Rechteeinräumung nicht geklärt. Aus der alleinigen Mitgliedschaft eines Urhebers in einer Verwertungsgesellschaft folgt nicht automatisch, dass dieser keine Rechte mehr einräumen kann. Insoweit ist auf die Ausführungen im vorherigen Absatz zu verweisen.
cc. Die Beklagte unterstellt zumindest indirekt, dass sich eine große Zahl von Mitgliedern (Urheber, Produktionsunternehmen, Sendeunternehmen) der gesamten Rechtekette im Rahmen des derivativen Erwerbs von Rechten vertragsbrüchig verhalten. Die daraus abgeleitete Annahme, dass die Klägerin von ihren Wahrnehmungsberechtigten die jeweiligen Rechte in großem Umfang nicht prioritär eingeräumt bekommen habe, ist nicht durch belastbare Tatsachen begründet. Die Beklagte unterstellt unberechtigterweise, dass seitens der Urheber gegenüber den Wahrnehmungsberechtigten der Klägerin und seitens der Wahrnehmungsberechtigten gegenüber der Klägerin über die prioritäre Einräumung von Rechten in der Rechtekette in großem Stil getäuscht wird.
Rechte werden der Klägerin nach deren Angabe durch die mit den Sendeunternehmen abgeschlossenen Verträge eingeräumt. Die Inhaberschaft der Sendeunternehmen an den vorliegend in Frage stehenden Rechten wird der Klägerin nach eigener, von der Beklagten nicht bestrittener Angabe durch ihre Wahrnehmungsberechtigten mit Abschluss des Wahrnehmungsvertrags ausdrücklich bestätigt. Aus der Umfrage der Klägerin im Jahr 2016 unter deren Wahrnehmungsberechtigten ergibt sich, dass 97,4 Prozent der für die Wahrnehmungsberechtigten der Klägerin tätigen Urheber mit den Sendeunternehmen Verträge abschließen, die einen totalen Buy-Out von Nutzungerechten enthalten. Da es keinen gutgläubigen Erwerb von Rechten gibt, ist Voraussetzung für die Wirksamkeit eines totalen Buy-Outs, dass über die zu übertragenden Rechte vorher nicht verfügt wurde. Nur dann können die Urheber alle ihre Rechte prioritär und damit wirksam zunächst an Sendeunternehmen und dann im Rahmen des derivativen Rechteerwerbs an die Klägerin übertragen. Den prozentualen Anteil der Verträge, die einen totalen Buy-Out beinhalten, bestreitet die Beklagte nicht, sondern verweist weiter darauf, dass die Frage der prioritären Rechteeinräumung an andere Verwertungsgesellschaft hätte geklärt werden müssen. Die Rechtssubjekte in der Kette des derivativen Erwerbs von Rechten schließen mithin fast durchweg Verträge, aus denen hervorgeht, dass sie Inhaber der zu übertragenden Rechte sind. Daher ist – entgegen der Ansicht der Beklagten – davon auszugehen, dass die Klägerin in großem Umfang Rechte von Sendeunternehmen wirksam übertragen bekommt. Die Beklagte vermag keine belastbaren Tatsachen benennen, aus denen hervorgeht, dass Urheber, bevor sie einen Vertrag mit einem totalen Buy-Out abschließen, vorher über ihre Rechte verfügt haben. Dies kann ohne Nachweise, wie etwa Statistiken, auch nicht unterstellt werden, da dies bedeuten würde, dass ein Großteil der Vertragspartner in unlauterer Absicht handeln würde, indem sie sich verpflichten, Rechte einzuräumen, über die nicht mehr verfügt werden kann, weil diese Rechte bereits im Wege der (Voraus-) Verfügung an eine Verwertungsgesellschaft übertragen wurden. Es kann nicht ohne belastbare Tatsachen unterstellt werden, dass im Bereich der Übertragung von (Nutzungs-) Rechten Rechtssubjekte regelmäßig in unlauterer Absicht handeln. Wie bereits ausgeführt, können die Angaben anderer Verwertungsgesellschaften gegenüber der Beklagten diese Annahme nicht untermauern. Auch anderen Verwertungsgesellschaften ist nach Aktenlage wohl nicht bekannt, ob ihre Wahrnehmungsberechtigten vor Abschluss eines Wahrnehmungsvertrags einen Werk-, Dienst- oder Arbeitsvertrag, der eine totale Buy-Out-Klausel enthält, abgeschlossen haben.
Das Gericht war trotz des entscheidungserheblichen Zeitpunkts des Erlasses des Widerspruchsbescheids auch nicht gehindert, die Ergebnisse der Umfrage aus dem Jahr 2016 heranzuziehen. Es handelt sich nicht um eine neue Tatsache, sondern um den Nachweis der bereits im Verwaltungsverfahren vorgebrachten und von der Beklagten angezweifelten Angabe, dass die Klägerin im Bereich des Hörfunks über abgeleitete Rechte mit einer Rechtedichte von 80 Prozent bei Angestellten und 69 Prozent bei freien Mitarbeitern und im Bereich des Fernsehens über eine Rechtedichte von 93 Prozent bei Angestellten und von 85 Prozent bei freien Mitarbeitern verfügt. Da – wie ausgeführt – nicht per se unterstellt werden kann, dass Mitarbeiter, die einen Vertrag mit einem totalen Buy-Out von Rechten unterzeichnen, nicht mehr über diese verfügen können, belegen die Ergebnisse der Umfrage aus dem Jahr 2016 die bereits im Verwaltungsverfahren gemachten Angaben der Klägerin mehr als deutlich: Aus der Umfrage aus dem Jahr 2016 ergibt sich im Einzelnen, dass im Bereich des Fernsehens 99,3 Prozent der festangestellten Arbeitnehmer und 92,3 Prozent der freien Mitarbeiter Verträge mit einem totalen Buy-Out von Rechten geschlossen haben. Im Bereich des Hörfunks haben 94,7 Prozent der festangestellten Arbeitnehmer und 79,4 Prozent der freien Mitarbeiter Verträge mit einem totalen Buyout von Rechten geschlossen. Insgesamt beträgt die Buy-Out-Quote 97,4 Prozent. Auch die Angabe der Klägerin im Verwaltungsverfahren, dass nur ein niedriger einstelliger Anteil der (gesamten) Mitarbeiter der Wahrnehmungsberechtigten der Klägerin in den Bereichen Hörfunk und Fernsehen Rechte an andere Verwertungsgesellschaften abgetreten habe, wird durch die Umfrage aus dem Jahr 2016 nicht widerlegt.
dd. Zwar wird es nicht auszuschließen sein, dass sich einzelne Vertragspartner vertragsbrüchig verhalten und prioritär ihre Rechte an eine Verwertungsgesellschaft übertragen haben. Vor dem Hintergrund des Prinzips der kollektiven Rechtewahrnehmung, das dem Urheberrechtswahrnehmungsgesetz bzw. dessen Nachfolger, dem Verwertungsgesellschaftengesetz, unausgesprochen zugrunde liegt, muss hingenommen werden, dass gegebenenfalls in Einzelfällen Rechte tatsächlich nicht an die Klägerin zur Wahrnehmung übertragen wurden. Dementsprechend führt der Bundesgerichtshof (BGH, U. v. 13.6.2002 – I ZR 1/00 – juris Rn. 32) im Zusammenhang mit der möglichen Verpflichtung einer Verwertungsgesellschaft zur Wahrnehmung der Rechte eines Miturhebers aus, dass „für eine Verwertungsgesellschaft der Erwerb von Rechten durch Wahrnehmungsverträge zum Zweck der treuhänderischen Wahrnehmung weitgehend ein Massengeschäft ist, das nur dann wirtschaftlich erfolgreich abgewickelt werden kann, wenn bei der Vertragsgestaltung in weitem Umfang typisiert und standardisiert wird.“ Die ordentliche Gerichtsbarkeit geht demnach davon aus, dass die Gestaltung von Wahrnehmungsverträgen und damit auch deren Abschluss typisiert und standardisiert zu erfolgen hat. Aufgrund dieses Massencharakters kann auf diesem Grundsatz der zivilgerichtlichen Rechtsprechung aufbauend von der Klägerin – wie von jeder anderen Verwertungsgesellschaft auch – nicht verlangt werden, ohne stichhaltige Anhaltspunkte zu überprüfen, ob die Einräumung von Rechten in Einzelfällen wegen fehlender Priorität ins Leere geht. Noch weniger kann verlangt werden, in allen Fällen der Frage nachzugehen, ob alle Rechte prioritär eingeräumt wurden. Wie bereits ausgeführt, kann aus dem geringen Rücklauf der Umfrage im Jahr 2012 nicht automatisch gefolgert werden, dass die Einräumung der Rechte regelmäßig ins Leere gelaufen ist.
Auch der Einwand der Beklagten, dass der Klägerin für die Ausschüttung an ihre Wahrnehmungsberechtigten bekannt sein müsse, welche Rechte sie im Einzelfall prioritär erlangt habe, verfängt nicht. Spiegelbildlich zum typisierten und standardisierten Abschluss von Wahrnehmungsverträgen gilt für die Verteilung der Einnahmen einer Verwertungsgesellschaft: „Diese Pflicht [die tatsächlichen Ermittlungen durchzuführen] wird jedoch dadurch begrenzt, dass die Beklagte als Treuhänderin der Berechtigten auch darum bemüht sein muss, ihren Verwaltungsaufwand in einem angemessenen Verhältnis zu den Erträgen und zu dem damit erreichbaren Mehr an Verteilungsgerechtigkeit zu halten” (BGH, U. v. 19.5.2005 – I ZR 299/02, juris Rn. 52). Daher ist anerkannt, dass „die gebündelte Wahrnehmung der Urheberrechte durch Verwertungsgesellschaften, deren Notwendigkeit der Gesetzgeber anerkannt und teilweise als zwingend für die Geltendmachung urheberrechtlicher Vergütungsansprüche zugrunde gelegt hat […], meist keine vollständig am Ausmaß der jeweiligen Werknutzung orientierte Ausschüttung der Erträge [gestattet]; vielmehr müssen die Berechtigten im Interesse eines möglichst geringen Verwaltungsaufwandes Schätzungen, Pauschalierungen und sonstige Vereinfachungen in der Berechnung hinnehmen, die sich aus dem wirtschaftlichen Gebot der Verhältnismäßigkeit ergeben, selbst wenn sie in Einzelfällen zu Benachteiligungen führen können“ (BGH, B. v. 3.5.1988 – KVR 4/87 – juris Rn. 21). Dementsprechend muss die Klägerin auch für die Ausschüttung an ihre Wahrnehmungsberechtigten nicht jede einzelne Rechteübertragung auf deren Priorität und damit deren Wirksamkeit prüfen.
ee. Auch der Vergleich der Zahl der Wahrnehmungsberechtigten einer anderen Verwertungsgesellschaft im Bereich Sprachwerke mit der Zahl der für Wahrnehmungsberechtigte der Klägerin tätigen Urheber kann keine grobe Unangemessenheit des Wiedergabetarifs begründen. Zwar mag es sein, dass die andere Verwertungsgesellschaft an rund 17.000 Personen im Jahr 2012 Ausschüttungen vornahm und die Klägerin nach den Hochrechnungen der Beklagten nur von 3.800 Urhebern Rechte erworben hat. Jedoch ist damit von der Beklagten keine Aussage über die Zahl der jeweils übertragenen Rechte getroffen. So ist es denkbar, dass eine vergleichsweise geringe Gruppe von bei Sendeunternehmen angestellten kreativen Arbeitnehmern erheblich mehr übertragbare Rechte erschaffen hat, als alle 17.000 Personen, an welche die andere Verwertungsgesellschaft Ausschüttungen vornimmt. Auch die Zahl von 9.672 freien Mitarbeitern und Arbeitnehmern der Wahrnehmungsberechtigten der Klägerin, die Verträge mit Total-Buy-Out-Klauseln geschlossen haben, deutet darauf hin, dass die Klägerin von wesentlich mehr als 3.800 Urhebern Rechte erworben hat. Zuguter Letzt besteht das Repertoire der Klägerin nicht nur aus den Rechten an Sprachwerken, sondern auch aus Rechten an Musikwerken und Filmwerken. Daher kann das Repertoire der Klägerin auch bei einem vermeintlich geringeren Umfang im Bereich der Sprachwerke insgesamt gleichwohl so groß sein, dass der Wiedergabetarif angemessen ist. Auch insoweit fehlt es an tragfähigen Feststellungen der Beklagten.
ff. Im Zusammenhang mit den Rechten an Sprachwerken hat die Beklagte vor allem mit einem Vergleich des (angeblichen) Repertoires einer anderen Verwertungsgesellschaft im Bereich der Sprachwerke argumentiert und versucht, den Umfang des Repertoires der Klägerin zu widerlegen. Aber auch die Feststellungen der Beklagten zum Umfang des Repertoires der Klägerin im Bereich der Musikwerke und der Filmurheberrechte beinhalten keine substantiierten, belastbaren Aussagen zum wirklichen Umfang des Repertoires der Klägerin in diesen beiden Bereichen. Die Beklagte hat in diesem Bereich lediglich „Anhaltspunkte“ und Rechte an bestimmten Werken „dürften für die Begründung der tariflichen Vergütung“ nach den Überlegungen der Beklagten eine geringe Relevanz aufweisen. Das Abstellen auf „Einschätzungen“ genügt ebenfalls nicht, den Repertoireumfang der Klägerin wirksam in Frage zu stellen.
gg. Ferner ist allgemein anerkannt, dass beispielsweise Kameramänner, Cutter und Regisseure in der Regel als Filmurheber anzusehen sind (Diesbach in Ahlberg/Götting, Beck’scher Online-Kommentar Urheberrecht, Stand 1.10.2016, § 92 UrhG Rn. 11 f.). Auch ausübende Künstler können etwa Rechte an Livesendungen erwerben und damit übertragen (vgl. Stang in Ahlberg/Götting, Beck’scher Online-Kommentar Urheberrecht, Stand 1.10.2016, § 78 UrhG Rn. 10). Nach § 94 Abs. 1 und Abs. 2 UrhG erwerben Filmhersteller Rechte und können diese auch übertragen. Teilweise werden diese Filmhersteller als „Producer“ bezeichnet, wobei in der Branche zahlreiche verschiedene Begrifflichkeiten des „Producers“ verwendet werden, die nicht immer deckungsgleich mit dem Begriff des Filmherstellers sind (Diesbach in Ahlberg/Götting, Beck’scher Online-Kommentar Urheberrecht, Stand 1.10.2015, § 94 UrhG, Rn. 10) Gleichwohl können entgegen der Ansicht der Beklagten auch „Producer“ Rechte erwerben. Deshalb, und weil die Beklagte auch nicht substantiiert darlegt, in welchem Umfang sich aufgrund der vermeintlich fehlenden Inhaberschaft von Rechten von Cuttern und ähnlicher Beteiligter an der Filmproduktion oder der ausübenden Künstler das Repertoire der Klägerin vermindern soll, geht auch dieser Ansatz, eine Unangemessenheit des Repertoires der Klägerin zu begründen, ins Leere.
4. Nach alledem sind Fragen der materiellen Beweislast im Zusammenhang mit dem Repertoire der Klägerin nicht entscheidend. Die Grundsätze der materiellen Beweislast greifen erst ein, wenn hinsichtlich einer erheblichen Tatsache eine Ungewissheit bleibt, die das Gericht trotz Ausschöpfens aller in Betracht kommenden Ermittlungen von Amts wegen, auch bei Berücksichtigung eines etwaigen unverschuldeten Beweisnotstands eines Beteiligten, nicht zu beseitigen vermag (BVerwG, B. v. 3.8.1988 – 9 B 257/88 – NVwZ-RR 1990, 165). Ein solcher Fall ist hier jedoch nicht gegeben. Die Klägerin hat bereits im Verwaltungsverfahren den Umfang ihres Repertoires dargelegt und dann durch die Umfrage im Jahr 2016 die zwischen den Beteiligten vor allem umstrittene Frage der Rechtedichte, den (prozentualen) Umfang der prioritären Rechteeinräumung, bestätigen können. Die von der Beklagten vorgebrachten Gründe können die von der Klägerin vorgetragenen Tatsachen hingegen, wie aufgezeigt, nicht erschüttern. Es ist davon auszugehen, dass für die von der Beklagten im Wege der Eingriffsverwaltung ausgeübte Staatsaufsicht allgemeine Grundsätze gelten und die Behörde die Folgen der Ungewissheit des Vorliegens der tatbestandlichen Voraussetzungen der zu einem Eingriffsakt ermächtigenden Rechtsnorm gegen sich gelten lassen muss. Der Gesetzgeber hat sich dafür entschieden, für das Aufstellen eines Tarifs kein Genehmigungsverfahren zu schaffen, in dem eine Verwertungsgesellschaft als Antragstellerin unter anderem darlegen müsste, dass ein (neuer) Tarif angemessen ist. Es läge demnach zunächst an der Beklagten, stichhaltige und dem Beweis zugängliche Tatsachen vorzutragen, die begründen, dass das Repertoire der Klägerin aufgrund zahlreicher prioritärer Rechteeinräumungen an andere Verwertungsgesellschaften deutlich weniger umfangreich ist, als von dieser vorgetragen.
II. Im Übrigen ist der feststellende Ausspruch des Tenors zu 1, dass der Wiedergabetarif unangemessen sei, nicht von der Rechtsgrundlage des Bescheids umfasst. Nach § 19 Abs.1 UrhWahrnG hat die Beklagte darauf zu achten, dass die Verwertungsgesellschaft den ihr nach diesem Gesetz obliegenden Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. § 19 Abs. 2 Satz 2 UrhWahrnG ermächtigt die Aufsichtsbehörde, nach eigenem Ermessen alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass eine Verwertungsgesellschaft die ihr obliegenden Verpflichtungen ordnungsgemäß erfüllt. Bei der Feststellung der Unangemessenheit des Tarifs handelt es sich nicht um eine Maßnahme, die sicherstellt, dass die Klägerin ihre gesetzlichen Pflichten erfüllt, sondern um eine bloße Feststellung, die noch nicht einmal zum Verständnis des Tenors zu 2 notwendig ist.
B. Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 154 Abs. 1 VwGO. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung beruht auf § 167 VwGO i. V. m. §§ 708 ff. ZPO.
Rechtsmittelbelehrung:
Nach §§ 124, 124 a Abs. 4 VwGO können die Beteiligten die Zulassung der Berufung gegen dieses Urteil innerhalb eines Monats nach Zustellung beim Bayerischen Verwaltungsgericht München,
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, oder
Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
beantragen. In dem Antrag ist das angefochtene Urteil zu bezeichnen. Dem Antrag sollen vier Abschriften beigefügt werden.
Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof,
Hausanschrift in München: Ludwigstraße 23, 80539 München, oder
Postanschrift in München: Postfach 34 01 48, 80098 München
Hausanschrift in Ansbach: Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach
einzureichen, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist.
Über die Zulassung der Berufung entscheidet der Bayerische Verwaltungsgerichtshof.
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Prozessbevollmächtigte zugelassen sind neben Rechtsanwälten und den in § 67 Abs. 2 Satz 1 VwGO genannten Rechtslehrern mit Befähigung zum Richteramt die in § 67 Abs. 4 Sätze 4 und 7 VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen.
Beschluss:
Der Streitwert wird auf EUR 50.000,00 festgesetzt (§ 52 Abs. 1 Gerichtskostengesetz -GKG- i. V. m. Streitwertkatalog für die Verwaltungsgerichtsbarkeit 2013, Nr. 1.7.2).
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes EUR 200,– übersteigt oder die Beschwerde zugelassen wurde. Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwaltungsgericht München,
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, oder
Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
einzulegen.
Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden.
Der Beschwerdeschrift eines Beteiligten sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.