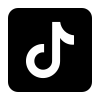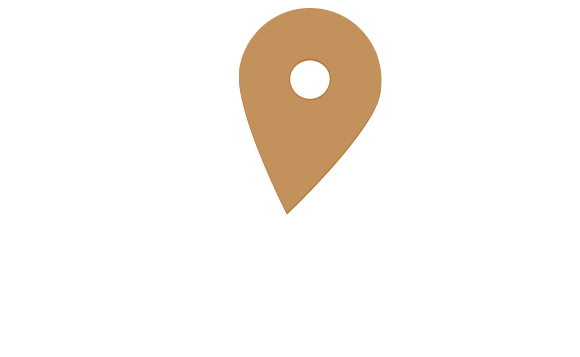Aktenzeichen L 2 U 244/15
SGB VI SGB VI § 9 Abs. 1
SGB VII § 2 Abs. 1 Nr. 1, § 3, § 6, § 9 Abs. 1 S. 2
Leitsatz
1. Zu den Voraussetzungen für die Anerkennung einer Berufskrankheit nach Nr. 3101 der Anlage 1 zur BKV bei Hepatitis C Infektion insbesondere zum Vorliegen einer erhöhten Infektionsgefahr. (amtlicher Leitsatz)
2. Bei der Behandlung von immungeschwächten Patienten auf onkologischem und dermatologischem Fachgebiet kann davon ausgegangen werden, dass der Durchseuchungsgrad hinsichtlich einer Hepatitis C Infektion mindestens dem Durchschnitt der Allgemeinbevölkerung entspricht. (amtlicher Leitsatz)
3. Eine Krankenschwester, die über längere Zeit regelmäßig u. a. Blut mit sog. Butterfly Verweilkanülen bei Patienten abgenommen hat, ist einer besonderen Infektionsgefahr aufgrund der Übertragungsgefahr bei der ausgeübten Verrichtung ausgesetzt. (amtlicher Leitsatz)
4 Zulässige Klageart zur Anerkennung einer Erkrankung als bestimmte Berufskrankheit ist die Anfechtungs- und Feststellungsklage. (redaktioneller Leitsatz)
Verfahrensgang
S 24 U 259/13 2015-05-21 GeB SGMUENCHEN SG München
Tenor
I.
Auf die Berufung der Klägerin wird der Gerichtsbescheid des Sozialgerichts München vom 21. Mai 2015 aufgehoben.
II.
Es wird festgestellt, dass die Hepatitis C-Erkrankung der Klägerin eine Berufskrankheit nach Nr. 3101 der Anlage 1 zur Berufskrankheitenverordnung ist.
III.
Die Beklagte trägt die außergerichtlichen Kosten der Klägerin in beiden Rechtszügen.
IV.
Die Revision wird nicht zugelassen.
Gründe
Die Berufung ist zulässig (§§ 143, 151 SGG) und begründet, da die Klägerin einen Anspruch auf Anerkennung einer Berufskrankheit nach Nr. 3101 der Anlage 1 zur BKV – Infektionskrankheiten, wenn der Versicherte im Gesundheitsdienst, in der Wohlfahrtspflege oder in einem Laboratorium tätig oder durch eine andere Tätigkeit der Infektionsgefahr in ähnlichem Maße besonders ausgesetzt war – hat.
Zulässige Klageart zur Anerkennung einer Erkrankung als bestimmte Berufskrankheit ist die Anfechtungs- und Feststellungsklage (§§ 54, 55 SGG).
Berufskrankheiten sind nach § 7 Abs. 1 des Siebten Buchs Sozialgesetzbuch (SGB VII) Versicherungsfälle. Berufskrankheiten sind dabei Krankheiten, die die Bundesregierung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates als Berufskrankheiten bezeichnet und die Versicherte infolge einer den Versicherungsschutz nach §§ 2, 3 oder 6 SGB VII begründenden Tätigkeit erleiden (§ 9 Abs. 1 Satz 1 SGB VII). Vorliegend betrifft der Rechtsstreit die Nr. 3101 der Anlage 1 zur BKV.
Nach ständiger Rechtsprechung des BSG ist für die Feststellung einer Listen-BK erforderlich, dass die Verrichtung einer grundsätzlich versicherten Tätigkeit (sachlicher Zusammenhang) zu Einwirkungen von Belastungen, Schadstoffen oder ähnlichem auf den Körper geführt hat (Einwirkungskausalität) sowie dass eine Krankheit vorliegt. Des Weiteren muss die Krankheit durch die Einwirkungen verursacht worden sein (haftungsbegründende Kausalität). Fehlt eine dieser Voraussetzungen, ist die Berufskrankheit nicht anzuerkennen. Dass die berufsbedingte Erkrankung gegebenenfalls den Leistungsfall auslösende Folgen nach sich zieht (haftungsausfüllende Kausalität), ist keine Voraussetzung einer Listen-Berufskrankheit. Dabei müssen die „versicherte Tätigkeit“, die „Verrichtung“, die „Einwirkungen“ und die „Krankheit“ im Sinne des Vollbeweises – also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit – vorliegen. Für die nach der Theorie der wesentlichen Bedingung zu beurteilenden Ursachenzusammenhänge genügt indes die hinreichende Wahrscheinlichkeit, allerdings nicht die bloße Möglichkeit (BSG, Urteil vom 23. April 2015 – Az. B 2 U 6/13 R – Rdnr. 10 bei Juris m. w. N. aus der ständigen Rechtsprechung). Hinsichtlich der Berufskrankheit nach Nr. 3101 der Anlage 1 zur BKV ist ergänzend das Merkblatt zur Berufskrankheit nach Nr. 3101 (Bek. des BMA vom 1. Dezember 2000, Bundesarbeitsblatt 2001 Hj. 1 S. 35) heranzuziehen.
Die Klägerin war unstreitig im Zeitraum vom September 1992 bis 30. April 2003 im Gesundheitsdienst – hier in der Klinik Haus B. in K-Stadt – tätig. Wesentlicher Inhalt des Begriffs Gesundheitsdienst ist der Dienst zum Schutz, zur Erhaltung, Förderung oder Wiederherstellung der Gesundheit gefährdeter Menschen oder zur Pflege unheilbar Kranker oder Gebrechlicher (vgl. Bayerisches Landessozialgericht, Urteil vom 13. August 2013, Az.: L 3 U 262/12). Bei der Klinik Haus B. handelt es sich vor allem ursprünglich um eine Reha-Klinik, die allerdings aufgrund besonderer finanzieller und organisatorischer Entwicklungen Veränderungen und Ergänzungen erfuhr. So erfolgte eine Angliederung der Fachklinik für Naturheilverfahren T.N. (im Juni 2000) und eine Integrierung einer onkologischen Klinik in der Zeit vom März 2001 bis März 2002 in die Klinik T.N.. Die Klägerin arbeitete, wie u. a. die Zeugen E. und Dr. D. bestätigten, auch als Krankenschwester in der onkologischen Abteilung. Die Zeugin E. schilderte, dass die Patienten der onkologischen Abteilung von dem Personal des Hauses B. mitversorgt wurden. Dies geschah vor allem nachts, wobei die Klägerin oftmals in der Nachtschicht arbeitete. Die Klägerin war somit im Gesundheitsdienst tätig und nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII versichert.
Hepatitis C, die bei der Klägerin im Jahre 2001 festgestellt und durch den Laborbefund vom Mai 2001 belegt wurde, ist eine Infektionskrankheit im Sinne der Nr. 3101 der Anlage 1 zur BKV. Die Übertragung erfolgt durch Körperflüssigkeiten, u. a. durch Blut oder Sexualverkehr. Das Übertragungsrisiko bei beruflichem Kontakt wird mit ca. 2 bis 10% angenommen (Merkblatt, a. a. O., Nr. 1.3.: im Vergleich dazu beträgt aber das Übertragungsrisiko bei beruflichem Kontakt mit Hepatitis B bis zu 100%, bei HIV nur 0,3%). Die Inkubationszeit beträgt zwischen 14 Tagen und bis zu sechs Monaten, im Mittel 50 Tage.
Die Listen-Berufskrankheiten nach § 9 Abs. 1 SGB VII in Verbindung mit der BKV sind in der Regel dadurch gekennzeichnet, dass Versicherte über einen längeren Zeitraum schädigenden Einwirkungen ausgesetzt sind und erst diese längerfristige Belastung zu der Erkrankung führt. Bei der Berufskrankheit Nr. 3101 besteht hingegen die Besonderheit, dass die schädliche Einwirkung, also der Ansteckungsvorgang, bei dem die Krankheit übertragen wurde, ein einmaliges, punktuelles Ereignis darstellt, das häufig im Nachhinein nicht mehr ermittelt werden kann. Meistens sind verschiedene Infektionsquellen und Übertragungswege denkbar, ohne dass sich feststellen lässt, bei welcher Verrichtung es tatsächlich zu der Ansteckung gekommen ist. Gerade aus diesem Grund sind Infektionskrankheiten, deren auslösendes Ereignis – die einmalige Ansteckung – an sich eher die Voraussetzungen des Unfallbegriffs erfüllt, als Berufskrankheit bezeichnet worden (BSG, Urt. v. 2. April 2009, Az.: B 2 U 30/07 R – juris Rn. 18; BSG, Urt. v. 21. März 2006, Az.: B 2
U 19/05 R – juris Rn. 15). Um den Nachweisschwierigkeiten zu begegnen, genügt bei der Berufskrankheit Nr. 3101 als „Einwirkungen“ im Sinne des § 9 Abs. 1 S. 2 SGB VII, dass der Versicherte einer der versicherten Tätigkeit innewohnenden „Infektionsgefahr besonders ausgesetzt“ war (BSG, Urt. v. 2. April 2009, a. a. O. – juris).
Die besondere, über das normale Maß hinausgehende Infektionsgefahr ist nicht Bestandteil eines Ursachenzusammenhanges zwischen versicherter Tätigkeit und Infektionskrankheit. Sie ersetzt vielmehr als eigenständiges Tatbestandsmerkmal die Einwirkungen und ist mit dem weiteren Tatbestandsmerkmal „Verrichtung einer versicherten Tätigkeit“ durch einen wesentlichen Kausalzusammenhang, hingegen mit der „Erkrankung“ nur durch die Möglichkeit eines Kausalzusammenhangs verbunden. Für die erhöhte Infektionsgefahr gelten damit hinsichtlich des Beweismaßstabes die Anforderungen, die ansonsten für das Tatbestandsmerkmal der Einwirkungen zu beachten sind. Sie muss im Vollbeweis vorliegen. Zwar setzt der Begriff der Gefahr eine Wahrscheinlichkeitsprognose voraus. Er charakterisiert einen Zustand, bei dem nach den objektiven Umständen der Eintritt eines Schadens als wahrscheinlich gelten kann. Allerdings ist zwischen der tatsächlichen Ebene, auf die sich die Wahrscheinlichkeitsprognose beziehen muss, und der rechtlichen Wertung, ob aufgrund der nachgewiesenen Tatsachen eine Schädigung möglich ist, zu unterscheiden (BSG, Urt. v. 2. April 2009, a. a. O. – juris; Hess. Landessozialgericht, Urt. v. 14. Juli 2015, Az.: L 3 U 132/11 – juris Rn. 42 ff).
Allein die Zugehörigkeit zu der Gruppe der im Gesundheitsdienst Tätigkeiten ist allerdings noch nicht ausreichend, um eine Anerkennung der Hepatitis C-Erkrankung als Berufskrankheit auszusprechen. Erforderlich ist vielmehr zusätzlich eine besondere Infektionsgefährdung unter den konkreten Bedingungen der individuellen Tätigkeit (Schönberger/Mehrtens/Valentin, Arbeitsunfall und Berufskrankheit, 8. Aufl., S. 707); die besonders hohe Infektionsgefahr müsste sich im Fall der Klägerin somit aufgrund ihrer Tätigkeit als Krankenschwester, hier im vollen Schichtbetrieb, in der Klinik Haus B. ergeben. Erforderlich ist nach der BSG-Rechtsprechung (BSG, Urt. v. 2. April 2009, a. a. O.) eine zweistufige Prüfung, nämlich
a) ob eine abstrakte Gefährdungslage bestand und
b) der Versicherte persönlich infolge seiner konkret ausgeübten Verrichtung einer erhöhten Infektionsgefahr ausgesetzt war (zum Ganzen: Mehrtens/Brandenburg, Die Berufskrankheitenverordnung, M 3101, S. 17).
Die Zeugin Dr. D. hat bestätigt, dass die Klägerin trotz ihrer anerkannten Ausbildung als Krankenpflegerin als Krankenschwester arbeitete. Sie übernahm alle anfallenden Aufgaben einer Krankenschwester, überwiegend in der Nachtschicht. Auch aus den übrigen Zeugenaussagen bestätigt sich, dass die Klägerin z. B. auch Infusionen wechselte, Blut entnahm, Spritzen setzte und insgesamt die verordnete Behandlungspflege vollzog. Es handelte sich also nicht nur um eine geriatrische Pflege, sondern – gerade auch im Hinblick auf die Anwendung naturheilkundlicher Verfahren – um eine Behandlungspflege. Dabei besteht auch bei naturheilkundlichen Verfahren, vor allem bei schwerstkranken Patienten wie hier bei Krebspatienten, der Bedarf, Spritzen und/oder Infusionen zu setzen sowie Infusionstherapien durchzuführen. Ein unmittelbarer Kontakt mit Blut ist – trotz Schutzhandschuhen oder Latex-Handschuhen – im Klinikalltag nicht ausgeschlossen, gerade bei Notfall- oder Stresssituationen oder, wie die Klägerin glaubhaft schilderte, bei Problemen, mit der Nadel eine Vene zu treffen. Es ist somit aufgrund der Tätigkeit der Klägerin als Krankenschwester von einer generellen Gefährdung und somit einer abstrakten Gefährdungslage im Sinne von a) auszugehen.
Nach Ansicht des Senats lag bei der Tätigkeit der Klägerin aber auch eine besonders hohe Infektionsgefahr (b) vor. Die Klägerin müsste einer der versicherten Tätigkeit innewohnenden Infektionsgefahr in besonderem Maße ausgesetzt gewesen sein (BSG, Urt. v. 2. April 2009, a. a. O.). Nicht erforderlich ist aber der Nachweis des konkreten Ansteckungsvorgangs; einen derartigen Nachweis, z. B. durch die Vorlage eines Auszugs aus dem Verbandbuch, wie im Fragebogen der Beklagten vom Oktober 2012 beispielhaft aufgeführt, oder durch Benennung eines konkreten Patienten oder eines Tages, kann die Klägerin nicht führen. Ausreichend ist auf der anderen Seite aber auch nicht eine „schlichte Infektionsgefahr“ (BSG, a. a. O.). Liegt eine erhöhte Infektionsgefahr vor, ist die haftungsbegründende Kausalität grundsätzlich gegeben (BSG v. 2. April 2009, Az.: B 2 U 7/08 R). Die Klägerin hat in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat aber glaubhaft und nachvollziehbar versichert, sich an einen einmaligen Vorgang bei der Entnahme von Blut in der Tagesschicht erinnern zu können, bei dem sie sich mit der Nadel gestochen hat. Sie könne dies jedoch nicht belegen.
Allgemein sind zwei Gesichtspunkte von Bedeutung für das Vorliegen der besonderen Infektionsgefahr (ausgehend v. BSG, Urt. v. 2. April 2009, a. a. O.), nämlich
aa) die Durchseuchung (Prävalenz) des Umfeldes der Tätigkeit und/oder
bb) die Übertragungsgefahr der ausgeübten Verrichtung (Mehrtens/Brandenburg, a. a. O., S. 18).
Die Durchseuchung des Arbeitsumfeldes auf der einen und die Übertragungsgefahr der versicherten Verrichtungen auf der anderen Seite stehen in einer Wechselbeziehung zueinander. An den Grad der Durchseuchung können umso niedrigere Anforderungen gestellt werden, je gefährdender die spezifischen Arbeitsbedingungen sind. Je weniger hingegen die Arbeitsvorgänge mit dem Risiko der Infektion behaftet sind, umso mehr erlangt das Ausmaß der Durchseuchung an Bedeutung. Allerdings muss zumindest die Möglichkeit einer Infektion bestehen. Ist das nicht der Fall, weil z. B. trotz eines hohen Durchseuchungsgrades die Art der konkret ausgeübten Tätigkeit einen Infektionsvorgang ausschließt, ist für die Annahme einer Gefahr von vornherein kein Raum. Kommt indes eine Infektion in Betracht, ist im Wege einer Gesamtbetrachtung der Durchseuchung und der Übertragungsgefahr festzustellen, ob sich im Einzelfall eine Infektionsgefahr ergibt, die nicht nur geringfügig erhöht ist, sondern in besonderem Maße über der Infektionsgefahr in der Gesamtbevölkerung liegt. Dabei legt der Nachweis einer infizierten Kontaktperson bei gleichzeitiger übertragungsgefährdender Tätigkeit das Vorliegen einer besonders erhöhten Infektionsgefahr nahe. Zwingend ist dieser Schluss aber nicht (BSG, a. a. O.).
Nach Überzeugung des Senat war vorliegend die Klägerin derartigen „Einwirkungen“ ausgesetzt, d. h., es bestand im Hinblick auf ihre konkrete Tätigkeit bezogen auf die Berufskrankheit Nr. 3101 eine besonders erhöhte Infektionsgefahr in o.g. Sinne.
Der Grad der Durchseuchung (aa) ist hinsichtlich der kontaktierten Personen als auch der Objekte festzustellen, mit oder an denen zu arbeiten ist. Lässt sich das Ausmaß der Durchseuchung nicht aufklären, kann aber das Vorliegen eines Krankheitserregers im Arbeitsumfeld nicht ausgeschlossen werden, ist vom Durchseuchungsgrad der Gesamtbevölkerung auszugehen (BSG, Urt. v. 2. April 2009, a. a. O.; Hess. Landessozialgericht, a. a. O., juris Rn. 44). Der Grad der Durchseuchung bezüglich HCV-Antikörper in der Gesamtbevölkerung beträgt ca. 0,5 bis 0,7% (vgl. auch BSG, a. a. O.; Schönberger/Mehrtens/Valentin, a. a. O., S. 717).
Die Übertragungsgefahr (bb) ist nach dem Übertragungsmodus der jeweiligen Infektionskrankheit sowie der Art, der Häufigkeit und der Dauer der vom Versicherten verrichteten gefährdenden Handlungen zu beurteilen. Ebenfalls zu beachten sind die individuellen Arbeitsvorgänge. Da für die Anerkennung der Berufskrankheit Nr. 3101 nicht eine schlichte Infektionsgefahr genügt, sondern eine (z. T. typisierend nach Tätigkeitsbereichen) besonders erhöhte Infektionsgefahr vorausgesetzt wird (§ 9 Abs. 1 S. 2 HS 1 SGB VII), kommt es darauf an, welche einzelnen Arbeitshandlungen im Hinblick auf den Übertragungsweg besonders gefährdend sind (BSG, Urt. v. 2. April 2009, a. a. O.; Hess. Landessozialgericht, a. a. O., juris Rn. 45).
Die Klägerin war einem derartigen besonders erhöhten Infektionsrisiko jedenfalls im Sinne der Fallgruppe bb) ausgesetzt. Bzgl. des Durchseuchungsgrades (aa) ist fraglich, ob in der Klinik tatsächlich Hepatitis C-Patienten behandelt wurden. Das LRA C-Stadt konnte derartige Meldungen der Klinik nicht bestätigen. Dies ergab auch eine aktuelle Anfrage beim LRA C-Stadt. Auch die Oberärztin Dr. D. hat – allerdings erst ab dem Jahre 2000 – angegeben, dass keine Hepatitis C-Patienten behandelt wurden bzw. dass sie sich an keinen Fall erinnern kann. Dass von der Klinik die Hepatitis-C-Fälle nicht an das gemeldet wurde, sind Vermutungen der Klägerin und von Zeugen, die jedoch nicht zu belegen sind. Die damalige Arbeitgeberin der T.N. ist insolvent gegangen; Ermittlungen des Senats waren hier nicht mehr möglich. Die W.P.W. GmbH konnte für die Zeit vor 1. Mai 2003 keine Aussagen machen.
Allerdings bestätigen die schriftlich vernommenen übrigen Zeugen – Fr. E., Hr. F. und Hr. A. – übereinstimmend, dass auch Hepatitis C-Patienten behandelt wurden. Belege für eine tatsächliche Infektion konnten von den Zeugen aber nicht vorgebracht oder benannt werden. Dabei wurde vielmehr überwiegend wie auch von der Klägerin auf die Schwächung des Immunsystems bei Patienten in onkologischer oder dermatologischer Behandlung hingewiesen. Derartige Patienten wurden ab 2000 bzw. 2001 nachweislich in der Klinik behandelt. Ob tatsächlich eine im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung erhöhte Infektionsquote vorlag, kann hierbei vermutet werden, ist aber nicht tatsächlich nachgewiesen.
Der Sachverständige Dr. M. hat in der ergänzenden Stellungnahme ausgeführt, es fehle am Nachweis einer besonders erhöhten Infektionsgefahr. Der Nachweis gelinge nicht, dass im Haus B. ein derartiges Klientel mit reduzierter Immunlage zwingend behandelt worden wäre. Mit Wahrscheinlichkeit sei dies aber als gegeben anzusehen. Der Vollbeweis einer besonders erhöhten Infektionsgefahr könne aber nicht geführt werden. Soweit er auf die Möglichkeit, dass die Klägerin sich die Erkrankung im Rahmen ihrer Ausbildung zur Krankenschwester zugezogen hat und dies über einen längeren Zeitraum unerkannt und latent geblieben ist, verweist, schließt sich der Senat dieser Einschätzung nicht an. Zum einen wurde nämlich die Klägerin zu Beginn ihrer Tätigkeit im deutschen Gesundheitswesen untersucht, wobei eine Hepatitis-C-Infektion trotz Blut- und Röntgenuntersuchung nicht festgestellt wurde. Entsprechendes gilt nach Angaben der Klägerin auch für den Beginn der Praktikumstätigkeit an der Klinik der LMU-A-Stadt im Dezember 1999. Zum anderen waren nach den Angaben des Gesundheitsamtes C-Stadt im Jahre 2003 die Testergebnisse des Betriebsarztes fünf bis sieben Jahren zuvor negativ. Unter Bezugnahme hierauf ist auch die Beklagte in einem Vermerk vom 24. Oktober 2012 von einer Infektion in den Jahren 1992 bis 2005 ausgegangen.
Der Nachweis von einer Häufung von Hepatits C-erkrankten Patienten vor allem seit 1. März 2001 in der Klinik kann somit nach Überzeugung des Senats nicht geführt werden. Wenn sich das Ausmaß der Durchseuchung nicht aufklären lässt, ist nach der BSG-Rechtsprechung (BSG v. 15. September 2011, NZS 2012, 151) vom Durchseuchungsgrad der Gesamtbevölkerung auszugehen. Der Durchseuchungsgrad entspricht damit auch vorliegend zumindest dem Durchschnitt der Allgemeinbevölkerung, wobei, gestützt auf das Gutachten des Dr. M., aufgrund der Behandlung von immungeschwächten Patienten auf onkologischem und dermatologischem Fachgebiet davon ausgegangen werden kann, dass der Durchseuchungsgrad über dem Durchschnitt der Allgemeinbevölkerung liegt. Jedenfalls ist statistisch ausgeschlossen, dass bei einer Belegung von bis zu 100 Patienten kein Patient mit Hepatitis C-Infektion behandelt wurde.
Eine besondere Infektionsgefahr nach der Fallgruppe aa) lässt sich hieraus allein somit nicht belegen. Anders beurteilt dies der Senat jedoch hinsichtlich der Fallgruppe bb). Eine besondere Infektionsgefahr aufgrund der Übertragungsgefahr bei der ausgeübten Verrichtungen richtet sich nach dem spezifischen Übertragungsweg der Infektionskrankheit (hier also die Übertragung durch Körperflüssigkeiten, insb. durch Blut) sowie der Art, Häufigkeit und Dauer der verrichteten gefährdenden Tätigkeit. Letzteres meint die potentiell übertragungsgeeigneten Kontakte oder ein besonders hohes Verletzungs- oder Inokulationsrisiko. Zweifellos ging die Klägerin nahezu bei jeder Arbeitsschicht mit Spritzen und Infusionsbesteck um. Dies ergibt sich auch aus den Erstangaben der Klägerin, insbesondere im Fragebogen vom 4. Oktober 2012; sie hat hierin die Spalte „1 – 10 x täglich“ angekreuzt bzgl. Umgang mit chirurgischen Nadeln, Umgang mit Venen- und Arterienkatheter und Injektionskanülen sowie bzgl. sonstiger invasiver Tätigkeit bei medizinischer Behandlung und Diagnostik, wobei die Klägerin auf das Setzen von Infusionen oder auf Wundverbände verwies. Zu einer Infektion mit dem Hepatitis C-Virus kann es insbesondere kommen, wenn sich die Klägerin mit der benutzten Nadel selbst gestochen hat. Wie oben dargelegt, gab es im Krankenhausalltag durchaus auch Situationen, bei denen hierbei keine Schutzhandschuhe getragen wurden. Dabei benutzte die Klägerin vor allem bei der Blutentnahme Nadeln mit einem großen Durchmesser bzw. sog. Butterfly-Kanülen. Das Hess. Landessozialgericht hat zu dieser Problematik ausgeführt (zitiert aus Hess. Landessozialgericht, a. a. O., juris Rn. 48):
„(…) daher kommen bei der HCV-Infektion als übertragungsgefährdend nur solche Tätigkeiten in Betracht, die erfahrungsgemäß mit der konkreten Gefahr von häufigen parenteralen Inokulationsereignissen im Sinne von Verletzungsereignissen verbunden sind, bei denen es zu einem erheblichen Blutaustausch kommt. Insbesondere ist die Nadelstichverletzung mit einer Hohlnadel ein geeigneter Übertragungsweg, der ein besonders hohes Übertragungsrisiko beinhaltet, da hier regelmäßig der Transfer relativ großer Mengen frischen Blutes möglich ist (BSG, Urteil vom 2. April 2009 – B 2 U 30/07 R – juris). Das Infektionsrisiko bei einer Stichverletzung mit einer für einen nachweislich infektiösen Patienten gebrauchten Nadel beträgt ungefähr 3% (Mehrtens/Brandenburg, Die Berufskrankheiten-Verordnung (BKV), Infektionskrankheiten, wenn der Versicherte im Gesundheitsdienst, in der Wohlfahrtspflege oder in einem Laboratorium tätig oder durch eine andere Tätigkeit der Infektionsgefahr in ähnlichem Maße besonders ausgesetzt war, Anhang 13.1; Schönberger/Mehrtens/Valentin, S. 718).“
Für das Hessische Landessozialgericht war im Folgenden u. a. maßgeblich, welche Art von Kanüle (dort: Butterfly-Verweilkanüle) verwendet wurde. Im Unterschied zur dort verwendeten Butterfly-Verweilkanüle könnten Insulinspritzen aufgrund ihrer geringeren Kanülendicke weniger Blut übertragen. Hinzu kommt der Umstand, dass Insulinspritzen nur subkutan und nicht intravenös verabreicht werden, was die Menge des infektiösen Blutes, welches potentiell aus der Injektionswunde austritt, erheblich minimiere.
Die Klägerin hat als vordergründig für eine mögliche Infektion eine Situation benannt, bei der eine Blutentnahme vorgenommen wurde. Hierbei werden regelmäßig Nadeln mit relativ großem Durchmesser verwendet, u. a. auch die Butterfly-Verweilkanüle. Auch ist der Senat aufgrund der Erstangaben der Klägerin und der Schilderung in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat davon überzeugt, dass die Klägerin regelmäßig mit Nadeln arbeiten musste, bei denen eine Kontaktaufnahme zwischen ihrem Blut und dem Blut eines Patienten kommen konnte. Bestätigt erscheinen vor allem auch Blutentnahmen von ein- bis zweimal in der Woche und deutlich häufigere, mehrmals tägliche intravenöse Kontaktmöglichkeiten beim Setzen oder Wechsel von Infusionen – auch wenn dort die Nadeldicke geringer als bei der Blutentnahme ist. Die Kanülendicke richtet sich regelmäßig auch nach dem jeweiligen Patienten.
Auch wenn die Übertragungswahrscheinlichkeit nach einer Nadelstichverletzung mit einer für einen nachweislich infektiösen Patienten gebrauchten Nadel gering ist, ist eine besondere Infektionsgefahr im Vergleich mit der Gefahr, die in der Bevölkerung allgemein hinsichtlich einer Infektion besteht, gegeben. Das Hess. Landessozialgericht (a. a. O., Rn. 50) hat hierzu ausgeführt, dass das Infektionsrisiko von Personen in der Allgemeinbevölkerung, die keiner Risikogruppe angehören, gegen Null tendiert. Dementsprechend ergibt sich aus dem Epidemiologischen Bulletin des Robert Koch Instituts 31/2014, dass im Jahr 2013 87% der Neuinfizierten, bei denen belastbare Angaben zum Übertragungsweg vorlagen, sich beim intravenösen Drogengebrauch infiziert hatten. Der allgemeine Risikoanteil in der Bevölkerung – außer bei Drogenabhängigen – ist also auch nach dieser Studie extrem gering. Demgegenüber steigt die Wahrscheinlichkeit einer Infektion bei Benutzung von Nadeln im Rahmen der Krankenhaustätigkeit. Es ist vorliegend wie oben nicht ausgeschlossen, dass Patienten mit Hepatitis C in der Klinik von der Klägerin behandelt wurden, vielmehr liegt der Durchseuchungsgrad mindestens so hoch wie bei der Allgemeinbevölkerung.
Dabei war die Klägerin auch nicht nur kurzzeitig einer besonderen Infektionsgefahr ausgesetzt, sondern im vollen Zeitraum der Behandlung von onkologischen Patienten in der Klinik von März 2001 bis März 2002 und auch in der Zeit davor, als u. a. seit Juni 2000 auch Patienten auf dermatologischem (z. B. mit Kortisonbehandlung) und sonstigem Fachgebiet behandelt wurden.
Eine besondere Infektionsgefahr nach der Fallgruppe bb) liegt damit unter Einbezug des dargelegten Durchseuchungsgrades nach Überzeugung des Senats vor. Der Verordnungsgeber unterstellt bei Vorliegen einer besonderen Infektionsgefahr typisierend den Ursachenzusammenhang nach Tätigkeitsbereichen (Mehrtens/Brandenburg, a. a. O., S. 19 f). Ein Ausschlussgrund wie unter Berücksichtigung der Inkubationszeit oder einer Erkrankung durch eine Infektion im unversicherten Lebensbereich ist hier nicht erkennbar und vorgebracht. Vor allem ist auch eine Erkrankung an Hepatitis C im engeren Familienkreis, insbesondere beim Ehemann, nicht gegeben.
Der Zeitpunkt der Infektion fällt unstreitig in den Zeitraum der Ausübung der gefährdenden Arbeitsvorgänge. Andere Ansteckungsrisiken sind bei der Klägerin nicht bekannt. Insbesondere ist wie oben dargelegt nicht anzunehmen, dass eine Infektion in die Zeit der Tätigkeit vor 1992 in B. fällt.
Es besteht damit ein Anspruch der Klägerin auf Feststellung der Hepatitis C-Erkrankung als Berufskrankheit nach Nr. 3101 der Anlage 1 zur BKV. Der Gerichtsbescheid des Sozialgerichts München und damit verbunden die streitgegenständlichen Bescheide vom 18. Dezember 2012 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 9. April 2013 waren daher aufzuheben.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 193 SGG.
Gründe für die Zulassung der Revision liegen nicht vor (§ 160 Abs. 2 SGG).