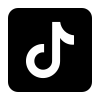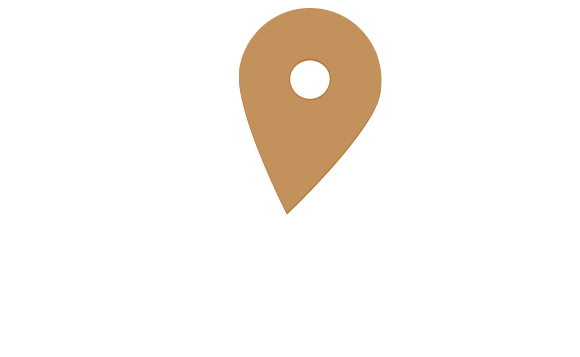Aktenzeichen AN 6 K 17.035831
Leitsatz
1. Ist ein Asylantrag rechtsmissbräuchlich gestellt worden, nur um eine aufwändige Krankheitsbehandlung im Bundesgebiet zu erlangen, ist im Rahmen des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG von einem atypischen Fall auszugehen, so dass dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bei Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen grundsätzlich ein von diesem auszuübendes Ermessen zukommt, ob es das Abschiebungsverbot feststellt oder versagt.
2. Daran hält die Kammer auch in Ansehung der Beschlüsse des BayVGH vom 18. Mai 2020 (2 B 19.34078 und 2 B 19.34090) fest.
Tenor
1. Die Beklagte wird unter entsprechender Aufhebung des Bundesamtsbescheides vom 20. Oktober 2017 verpflichtet, über die Zuerkennung eines Abschiebungsverbotes gemäß § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG bei der Klägerin unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut zu entscheiden. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
2. Die Kosten des Verfahrens haben die Klägerin und die Beklagte jeweils zur Hälfte zu tragen. Gerichtskosten werden nicht erhoben.
3. Das Urteil ist hinsichtlich der Kostenentscheidung vorläufig vollstreckbar. Der jeweilige Vollstreckungsschuldner kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe der festgesetzten Kosten abwenden, wenn nicht der jeweilige Vollstreckungsgläubiger Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
Gründe
Gemäß § 102 Abs. 2 VwGO kann aufgrund des in der Ladung erteilten entsprechenden Hinweises auch in Abwesenheit der Beklagten verhandelt und entschieden werden.
Ausweislich des Klageantrags und der Klageschrift wendet sich die Klägerin mit ihrer Klage nur gegen Ziffer 4 bis 6 des Bundesamtsbescheides vom 20. Oktober 2017 und begehrt die Verpflichtung des Bundesamtes, der Klägerin humanitären Abschiebungsschutz nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG zuzubilligen, und wendet sich gegen die Ausreiseaufforderung nebst Fristsetzung und Abschiebungsandrohung.
Diese Klage ist zulässig und teilweise begründet.
Diesem Klageantrag ist insoweit stattzugeben, als die Beklagte unter entsprechender Aufhebung des streitgegenständlichen Bundesamtsbescheides vom 20. Oktober 2017 zu verpflichten ist, über die Zuerkennung eines Abschiebungsverbotes nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG bei der Klägerin unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut zu entscheiden. Im Übrigen – soweit die Klägerin eine darüber hinaus gehende Verpflichtung der Beklagten begehrt – ist die Klage jedoch mangels Begründetheit abzuweisen.
Die Tatbestandsvoraussetzungen für ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG sind vorliegend erfüllt.
Gemäß § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG soll von einer Abschiebung eines Ausländers in einen anderen Staat abgesehen werden, wenn dort für diesen eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht. Eine erhebliche konkrete Gefahr aus gesundheitlichen Gründen, wie sie für die Klägerin hier ausschließlich geltend gemacht wird, liegt nach Satz 2 dieser Vorschrift nur vor bei lebensbedrohlichen oder schwerwiegenden Erkrankungen, die sich durch die Abschiebung wesentlich verschlechtern, also zu außergewöhnlich schweren körperlichen oder psychischen Schäden führen würden, wobei die wesentliche Verschlechterung alsbald nach der Rückkehr in den Zielstaat eintreten müsste (vgl. VG Augsburg, U.v. 1.10.2018 – Au 5 K 17.32950). Eine entsprechende Gefahr kann sich auch daraus ergeben, dass der erkrankte Ausländer eine an sich im Zielstaat verfügbare medizinische Behandlung dort tatsächlich nicht erlangen kann. Dies kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn die notwendige Behandlung oder Medikation dem betroffenen Ausländer aus finanziellen Gründen nicht zugänglich ist (BVerwG, U.v. 29.10.2002 – 1 C 1.02). Allerdings muss sich der Ausländer grundsätzlich auf den im Heimatland vorhandenen Versorgungsstand im Gesundheitswesen verweisen lassen. Denn § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG garantiert keinen Anspruch auf „optimale Behandlung“ einer Erkrankung oder auf Teilhabe an dem medizinischen Standard in Deutschland. Der Abschiebungsschutz soll den Ausländer vielmehr vor einer gravierenden Beeinträchtigung seiner Rechtsgüter bewahren (OVG NW, B.v. 14.6.2005 – 11 A 4518/02.A). Dass die medizinische Versorgung im Zielstaat (Armenien) mit der Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland gleichwertig oder überall gewährleistet ist, ist hierbei nicht erforderlich (§ 60 Abs. 7 Satz 3 und 4 AufenthG).
Gemessen an diesen Maßstäben ist entgegen der Auffassung der Beklagten im streitgegenständlichen Bescheid für die Klägerin unter Berücksichtigung der Erkrankungen der Klägerin und der Auswirkungen der Corona-Pandemie derzeit vom Vorliegen einer erheblichen konkreten Gefahr im Sinne des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG aus gesundheitlichen Gründen bei Rückkehr in ihr Heimatland auszugehen.
Aufgrund dessen ist die Klage insoweit begründet, als die Klägerin gegen die Beklagte unter Berücksichtigung des oben Gesagten einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Neuverbescheidung hat. Ein darüber hinausgehender Anspruch auf Feststellung eines Abschiebungsverbotes besteht vorliegend jedoch nicht. Insoweit bleibt das Verpflichtungsbegehren der Klägerin nur teilweise erfolgreich.
Die Klägerin ist nach den vorgelegten ärztlichen Attesten auch nach der erfolgreichen Beendigung der Chemotherapie im August 2017 wegen der Erkrankung an einer akuten lymphatischen Leukämie auf eine engmaschige (achtwöchentlicher Rhythmus) medizinische Versorgung angewiesen. Die onkologische Nachbetreuung mit regelmäßigen Blutbildkontrollen ist bis zehn Jahre nach Therapieende erforderlich. Die Nachbetreuung und medizinische Versorgung ist derzeit im Heimatland für die Klägerin nach Auffassung des Gerichts wegen der Corona-Pandemie nicht erreichbar.
Wie aus den zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemachten Berichten der Konrad-Adenauer-Stiftung, der Heinrich-Böll-Stiftung, eines WIKIPEDIA-Artikels über die Covid-19-Pandemie in Armenien und der Verlautbarung der WKO Österreich zu entnehmen ist, ist zwischenzeitlich auch Armenien von der COVID-19-Pandemie erfasst worden. Am 16. März 2020 rief die Regierung den andauernden Ausnahmezustand (zunächst bis 12.8.2020 verlängert) aus, die Grenzen sind geschlossen und es besteht ein öffentliches Versammlungsverbot. Sowohl die Infektionszahlen als auch die Todeszahlen sind angesichts einer Bevölkerung von knapp drei Millionen Menschen erheblich (am 7.7.2020: 17.064 Infizierte und 285 Tote mit steigender Tendenz). Das bereits vorher finanziell unterversorgte Gesundheitssystem versagt, nur noch Infizierte mit erheblichen Symptomen können in die Krankenhäuser aufgenommen werden. Das Erkrankungsrisiko der Klägerin, die wohl als Risikopatientin einzustufen ist, ist daher derzeit in Armenien erheblich. Die Pandemie hat außerdem auch massive Auswirkungen auf das dortige gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben und die Infrastruktur des schwachen Gesundheitssystems. Die Corona-Pandemie hat in Armenien zu Einkommenseinbußen, Entlassungen und Betriebsschließungen geführt. Nach der obligatorischen Schließung sahen sich Tausende von Menschen in Armenien, die entweder im Ausland – hauptsächlich in Russland -, oder als Tagelöhner im Dienstleistungs- und Bausektor, arbeiten, ernsthaften finanziellen Einbußen ausgesetzt (Heinrich-Böll-Stiftung: „Das Coronavirus hat Armenien den Krieg erklärt“ vom 7.7.2020).
In Konsequenz dieser Entwicklungen muss für den Fall der Klägerin davon ausgegangen werden, dass für sie derzeit – soweit eine Einreise derzeit überhaupt möglich ist – das Gesundheitssystem Armeniens nicht zuverlässig erreichbar ist, sie ohne erhebliche Infektionsgefahr weder ihre regelmäßigen onkologischen Nachuntersuchungen durchführen lassen kann noch wegen der neuerdings attestierten Störung des Sozialverhaltens zuverlässig psychotherapeutische Behandlung wahrnehmen könnte. Die Klägerin ist jedoch unbedingt auf regelmäßige Kontrollen zur Feststellung eines möglichen Leukämie-Rezidivs angewiesen zumal im Falle eines Rezidivs jedenfalls derzeit eine Behandlung in Armenien nicht möglich wäre.
Zwar war nach dem Lagebericht des Auswärtigen Amtes vom 27. April 2020 (Stand: Februar 2020) die medizinische Grundversorgung vor der Corona-Pandemie flächendeckend gewährleistet und die stationäre und ambulante Behandlung von psychischen Störungen auf gutem Standard kostenlos verfügbar, jedoch kann davon nach Ausbruch der Corona-Pandemie nicht mehr ohne weiteres ausgegangen werden.
Diese Problematik betrifft insbesondere die vorerkrankte, bis August 2017 mit Chemotherapie (unter anderem dem Immunmodulator Methotrexat) behandelte Klägerin, die zuverlässig regelmäßige Nachsorgeuntersuchungen durchführen muss und dabei einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt ist.
Allerdings besteht keine unmittelbar lebensbedrohliche Situation nach einer Abschiebung, angesichts der anhaltenden Erstremission der akuten lymphatischen Leukämie und des Schweregrades der psychischen Problematik kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass auch die Voraussetzungen für einen Anspruch nach § 60 Abs. 5 AufenthG vorliegen.
Abschiebeschutz nach dieser Vorschrift hat das Bundesamt daher rechtsfehlerfrei verneint.
Zwar sind – wie dargelegt – die Tatbestandsvoraussetzungen des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG entgegen der Annahme der Beklagten hier gegeben. Bei § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG handelt es sich jedoch gemäß seinem Wortlaut um eine „Soll“-Vorschrift. Liegen die Tatbestandsvoraussetzungen des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG vor, soll als Rechtsfolge von einer Abschiebung abgesehen werden (vgl. insofern auch die Gesetzesbegründung in BT-Drs. 15/420 S. 91: „soll […] normalerweise […]“). Die Regelung in einer Rechtsvorschrift, dass eine Behörde sich in bestimmter Weise verhalten soll, bedeutet zwar eine strikte Bindung für den Regelfall, gestattet jedoch Abweichungen in atypischen Fällen, bei denen aufgrund besonderer, konkreter Gründe der „automatische“ Eintritt der regelmäßigen Rechtsfolge nicht mehr von der Vorstellung des Gesetzgebers getragen wird. Dieses reduzierte Ermessen ist bei Entscheidungen über Asylanträge nach dem Asylgesetz, wie hier, seit dem Inkrafttreten des Richtlinienumsetzungsgesetzes im Jahr 2007 auch nicht mehr der Ausländerbehörde, sondern dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zugewiesen (vgl. etwa Bodenbender in GK-AsylG § 24 Rn. 12 f., m.w.N.). Das Bundesamt darf bei seiner Entscheidung zu einem Abschiebeverbot nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG von der Regel dementsprechend in solchen Fällen abweichen, in denen die für den Normalfall geltende Regelung von der ratio legis nicht mehr gefordert wird (vgl. Ramsauer in Kopp/Ramsauer, 18. Auflage 2017, § 40 Rn. 64 m.w.N.).
Von einer solchen Fallgestaltung ist im Rahmen des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG nach der Auffassung des Gerichts (anders: BayVGH vom 18.5.2020 – 2 B 19.34078 und 2 B 19.34090) aber nunmehr jedenfalls grundsätzlich dann auszugehen, wenn ein Ausländer allein deshalb hier einen Asylantrag unter Missbrauch dieses Verfahrens stellt, um im Bundesgebiet unter Inanspruchnahme der hiesigen Versorgungssysteme eine gesundheitliche Behandlung zu erhalten, und wenn zudem aufgrund der voraussichtlichen Dauer oder Intensität der erforderlichen Gesundheitsbehandlung ganz erheblicher Aufwand oder erhebliche Kosten für die hiesigen Gesundheits-/Sozialsysteme zu erwarten sind. Der Gesetzgeber hat die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern unter Berücksichtigung des jeweiligen Aufenthaltszwecks einer differenzierten gesetzlichen Regelung unterzogen, wobei insbesondere auf den Schutz der Sozial- und Gesundheitssysteme vor etwaigen Belastungen ein besonderes Augenmerk gelegt wird (vgl. etwa § 5 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG, Art. 15 der Verordnung (EG) Nr. 810/2009). Vor diesem Hintergrund ist gerade nicht davon auszugehen, dass der Gesetzgeber in § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG für solche Konstellationen einen Abschiebeschutz als gesetzlichen Regelfall vorsehen wollte, in denen Ausländer (rechtsmissbräuchlich) über das Asylverfahren eigentlich eine Krankenbehandlung im Bundesgebiet – unter Umgehung des insofern vorgesehenen aufenthaltsrechtlichen Verfahrens – erstreben.
Für die Eröffnung des Verwaltungsermessens in § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG bei derartigen Fällen spricht im Übrigen zugleich die Regelung in § 60 Abs. 7 Satz 6 AufenthG. Nach dieser Vorschrift sind Gefahren, denen die Bevölkerung oder Bevölkerungsgruppe allgemein ausgesetzt sind, nach § 60a Abs. 1 Satz 1 AufenthG zu berücksichtigen. Sie fallen demnach grundsätzlich nicht unter § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG. Mit dieser Regelung soll nach dem Willen des Gesetzgebers erreicht werden, dass dann, wenn eine bestimmte Gefahr der ganzen Bevölkerung bzw. Bevölkerungsgruppe im Zielstaat gleichermaßen droht, über deren Aufnahme oder Nichtaufnahme nicht im Einzelfall durch das Bundesamt, sondern für die ganze Gruppe der potenziell Betroffenen einheitlich durch eine politische Leitentscheidung des Innenministeriums im Wege des § 60a AufenthG befunden wird (BVerwG, U.v. 13.6.2013 – 10 C 13.12 – Rn. 13 m.w.N.).
Zwar sind die dortigen Tatbestandsvoraussetzungen hier nicht erfüllt, die Regelung bestätigt jedoch die Annahme einer Aktivierung des Rest-Ermessens in § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG in der oben dargestellten Missbrauchskonstellation, denn der in Satz 6 als Ausnahme von § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG ausformulierte Tatbestand ist maßgeblich dadurch gekennzeichnet, dass wegen der nicht durch den individuellen Einzelfall geprägten Umstände, wegen der erheblichen Zahl der in gleicher Weise „Betroffenen“ und wegen der daraus folgenden Konsequenzen für die Bundesrepublik Deutschland als Aufnahmestaat gerade keine gebundenen Einzelfallentscheidungen erfolgen sollen. Eine vergleichbare Situation, die der Gesetzgeber so nicht bei der erstmaligen Einführung dieser Regelung in das Ausländerrecht und auch nicht bei deren Übernahme in das AufenthG im Jahr 2004 im Blick hatte, sondern sich vielmehr erst danach entwickelt hat, ergibt sich aus dem gehäuften, zielgerichteten, erfolgreichen Missbrauch des Asylverfahrens, allein um sich so wegen des (schwer) defizitären Sozial- und Gesundheitssystems im Herkunftsland Zugang zu den Gesundheits-/Sozialsystemen der Bundesrepublik Deutschland für eine aufwändige Betreuung und Behandlung bei Erkrankungen zu verschaffen. Dieses Phänomen, das bezogen auf das Herkunftsland Armenien nach den Erfahrungen der Kammer schon systematische Züge angenommen hat, ist auch keineswegs auf dieses Herkunftsland beschränkt, sondern hat gerade in den letzten Jahren – mit einem Schwerpunkt bei den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion, aber beileibe nicht nur dort – immer weiter um sich gegriffen, so dass sich die Vergleichbarkeit mit einer Bevölkerungsgruppe in diesem Sinn aufdrängt (vgl. zu einer direkten Anwendung des damaligen § 60 Abs. 7 Satz 5 AufenthG wegen der unzureichenden medizinischen Versorgungslage in einem Herkunftsland BayVGH, B.v. 21.9.2016 – 10 C 16.1164 – juris). Mithin führen diese Überlegungen ebenso dazu, dass es bei Tatbestandserfüllung des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG in derartigen (Rechtsmissbrauchs-)-Fällen vor der Feststellung eines Abschiebehindernisses grundsätzlich noch der Betätigung des dort in atypischen Fällen eröffneten Ermessens – ggf. aufgrund ermessenslenkender Vorgaben – von Seiten der Exekutive bedarf, die das Gericht nicht ersetzen kann (vgl. § 114 VwGO).
An dieser Rechtsauffassung hält die Kammer auch in Ansehung der Beschlüsse des Bayerischen Verwaltungsgerichthofs vom 18. Mai 2020 (2 B 19.34078 und 2 B 19.34090) fest. § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG enthält ausdrücklich eine bloße Soll-Regelung, d.h. wenn die Tatbestandsvoraussetzungen gegeben sind, tritt nur im Regelfall die dort genannte Rechtsfolge ein. Dementsprechend ist unter Heranziehung der Gesetzessystematik und des Gesetzeszwecks zu bestimmen, wann bzw. ob konkret für den zu entscheidenden Fall ein vom Regelfall abweichender atypischer Fall besteht, der die im Gesetz vorgegebene Rechtsfolge ausnahmsweise in das Ermessen der entscheidenden Behörde stellt. In diesem Rahmen ist zur Überzeugung der Kammer entgegen der in den oben genannten Beschlüssen des 2. Senats des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vertretenen Auffassung darauf abzustellen, ob der/die betreffende Ausländer/in – wie hier die Klägerin – sich den Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland lediglich mittels eines rechtsmissbräuchlichen Asylantrags verschafft hat. Denn die Rechtsstellung, die die Klägerin hier geltend macht – ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG und damit die weitere Aufenthaltnahme in der Bundesrepublik Deutschland – kann nur dann erlangt werden, wenn sich der/die Betreffende in der Bundesrepublik Deutschland aufhält; denn das Vorliegen oder Geltendmachen der Tatbestandsvoraussetzungen des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG verleiht – anders als bei den asylrechtlichen Tatbeständen – gerade kein direktes Recht auf Einreise und Aufenthaltnahme in der Bundesrepublik Deutschland. Diese behält sich außerhalb des Asylrechts ausländerrechtlich grundsätzlich vor, in einem gesonderten (Visum-)-Verfahren über die Berechtigung zur Aufenthaltnahme anhand des tatsächlichen Aufenthaltszweckes zu entscheiden, bevor der/die Ausländer/in überhaupt in die Bundesrepublik Deutschland einreist. Mithin darf jedenfalls dann, wenn – wie hier – mit diesem Aufenthalt ganz erhebliche Belastungen der Allgemeinheit einhergehen, bei der Anwendung von § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG nicht außer Acht bleiben, auf welche Weise der/die Ausländer/in den Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland erlangt hat. Wenn dies – wie hier – mittels eines rechtsmissbräuchlich gestellten Asylantrages erfolgt ist, also eines Asylantrages, bei dem offensichtlich der Zweck der asylrechtlichen Schutzgewährung verfehlt wird, sei es durch eine völlig fehlende Berufung auf potentielle derartige Gründe, sei es durch eindeutig nur vorgeschobene Asylantragsgründe, die den wahren Einreisegrund (Krankheitsbehandlung) verschleiern sollen, verlangen Gesetzeszweck und Gesetzessystematik sowie der Gedanke der Gleichbehandlung mit denen, die bei Erkrankungen nicht den Weg der rechtsmissbräuchlichen Asylantragstellung einschlagen, die Berücksichtigung dessen bei der Entscheidung nach § 60 Abs. 7 AufenthG. Es liegt so ein atypischer Fall vor, das Rest-Ermessen der Soll-Bestimmung ist eröffnet. Die Exekutive hat dann in Ausübung dieses Ermessens zu prüfen und zu entscheiden, ob die grundsätzlich vorgesehene Rechtsfolge der Bestimmung auch in diesem atypischen Fall eintreten soll. Es ist nicht Sache der Rechtsprechung vorzugeben, wie bei derartigen Konstellationen das Ermessen – sinnvollerweise mittels allgemeiner ermessenslenkender Vorgaben der ministeriellen Ebene – auszuüben wäre; die Ausübung anhand des Gesetzeszweckes und der Gesetzessystematik wird sich jedenfalls wohl grundsätzlich an der Schwere der Folgen der Rückführung für den/die Betroffene/n, die sonstigen Gegebenheiten der Person und deren Verhalten und an den mit der Fortdauer des Aufenthalts des/der Betreffenden verknüpften Folgen für die Belange der Bundesrepublik Deutschland zu orientieren haben. Dies erhellt sich insbesondere auch daraus, worauf die Kammer ebenfalls bei ihrer Rechtsprechung zur Auslegung des § 60 Abs. 7 AufenthG unterstützend abstellt (vgl. oben), dass Verhältnisse eingetreten sind, die bei dieser Konstellation der Aufenthaltnahme mittels rechtsmissbräuchlich gestellten Asylantrages die Heranziehung des hinter § 60 Abs. 7 Satz 6 i.V.m. § 60a Abs. 1 AufenthG stehenden Rechtsgedankens im Rahmen des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG nahelegen.
Die Klägerin ist hier mit ihren Eltern nur mit einem Kurzaufenthaltsvisum für Tschechien nach Deutschland eingereist und hat zur weiteren Aufenthaltnahme Asylantrag gestellt. Aus den Äußerungen der sie begleitenden Eltern im Asylantragsverfahren geht eindeutig hervor, dass die Klägerin und ihre Eltern wegen der unzulänglichen Versorgungssituation im Heimatland nur zur Erlangung der (aufwändigen) medizinischen Behandlung, die für sie hier im Wesentlichen auch kostenfrei ist, in die Bundesrepublik Deutschland eingereist sind und deshalb hier Aufenthalt bezwecken. Diese Aufenthaltnahme wäre so bei Einhaltung der Vorgaben des ausländerrechtlichen Visum-Verfahrens nicht möglich gewesen. Die Kammer ist davon überzeugt, dass es sich hierbei um einen atypischen Fall der Anwendung des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG handelt und es daher grundsätzlich der Ausübung des in diesen Fällen eingeräumten Ermessens durch die Exekutive bedarf.
Ausnahmsweise ist allerdings – wie auch zu § 60 Abs. 7 Satz 6 AufenthG – das Ermessen des Bundesamtes in der skizzierten Missbrauchskonstellation dann zu Gunsten des Asylbewerbers auf Null reduziert, wenn seine Gefährdung nach Abschiebung im Zielstaat das Ausmaß der sogenannten extremen Gefahr (die seit der grundlegenden Entscheidung des BVerwG v. 12.7.2001 – 1 C 5.01 – juris mit der Formel „gleichsam sehenden Auges dem sicheren Tod oder schwersten Verletzungen ausgeliefert würde“ umschrieben wird) erreicht. Denn dann ist von Verfassung wegen (Art. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) die Zuerkennung von Abschiebeschutz unmittelbar geboten. Vorstellbar ist andererseits außerdem, dass im Einzelfall das Ermessen auf Null in Richtung auf die Versagung des Abschiebungsschutzes nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG reduziert ist.
Im Fall der Klägerin liegen hier aber die oben genannten Voraussetzungen für die Eröffnung des Ermessens auf Rechtsfolgenseite vor, ohne dass dieses in der einen oder anderen Richtung auf Null reduziert wäre. Denn zum einen sind hier keine zwingend für die Versagung des Abschiebungsschutzes sprechende Gründe ersichtlich. Zum anderen erreicht der Gesundheitszustand der Klägerin insbesondere nicht das Stadium der gerade benannten extremen Gefahr (vgl. bereits oben zu § 60 Abs. 5 AufenthG).
Von Rechts wegen allerdings nicht bestehen bleiben können gegenüber der Klägerin außerdem noch die Ausreiseaufforderung mit Abschiebungsandrohung in Nr. 5 und der Ausspruch zum Einreise- und Aufenthaltsverbot gemäß § 11 Abs. 1 AufenthG in Nr. 6 des streitgegenständlichen Bundesamtsbescheides vom 20. Oktober 2017. Diese sind mit aufzuheben, weil – bezüglich Nr. 5 – der Klägerin damit bereits die Abschiebung angedroht ist, obwohl die gemäß § 31 Abs. 5, § 34 Abs. 1 AsylG zwingend vorrangige Entscheidung über ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG erst noch zu treffen ist, und weil – bezüglich Nr. 6 – darin trotz des vordergründigen gesetzlichen Wortlauts in § 11 AufenthG überhaupt erst die Verhängung des Einreise- und Aufenthaltsverbotes nach § 11 Abs. 1 AufenthG im Einzelfall begründet liegt (vgl. dazu BVerwG, B.v. 13.7.2017 – juris, LS 1, Rn. 70 ff), die wiederum maßgeblich vom Bestehen einer Abschiebungsandrohung abhängt.
Da somit der hier zur Entscheidung stehenden Klage teilweise stattgegeben wird, erfolgt die Kostenentscheidung nach § 161 Abs. 1, § 155 Abs. 1 VwGO unter Berücksichtigung des Umfangs des Obsiegens hälftig zu Lasten der Beteiligten.
Gerichtskosten fallen nicht an, da das Verfahren gemäß § 83b AsylG gerichtskostenfrei ist.
Der Ausspruch hinsichtlich der vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 Abs. 1 und Abs. 2 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11, § 711 ZPO.