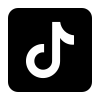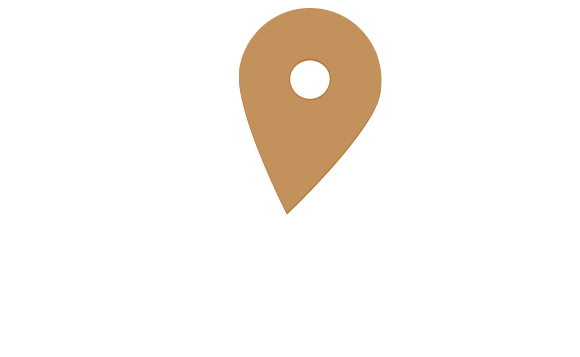Aktenzeichen B 5 K 16.539
Leitsatz
Ein orthopädischer Körperschaden kann mangels hinreichend wahrscheinlichen Kausalzusammenhangs nicht als Folge eines Dienstunfalls anerkannt werden, wenn bereits eine degenerative Vorschädigung bestand und das Unfallereignis nicht geeignet war, einen derartigen Körperschaden herbeizuführen. (redaktioneller Leitsatz)
Tenor
1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens.
3. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar.
Gründe
1. Die zulässige Klage hat in der Sache keinen Erfolg. Der Bescheid des Beklagten vom 20. August 1998 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 1. Juli 2013 ist rechtmäßig und verletzt die Klägerin nicht in ihren Rechten (§ 113 Abs. 5 Satz 1, Abs. 1 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)). Die Klägerin hat weder einen Anspruch auf Anerkennung des Ereignisses vom 14. September 1997 als Dienstunfall mit den in Nr. 2 des Klageantrags vom 24. Oktober 2013 – in der in der mündlichen Verhandlung modifizierten Fassung – aufgeführten Gesundheitsstörungen als Dienstunfallfolgen noch einen Anspruch auf Neuverbescheidung ihres Antrags auf Festsetzung einer Minderung der Erwerbsfähigkeit. Zur Begründung nimmt das Gericht auf die zutreffenden Gründe des Widerspruchsbescheids Bezug und macht sie zum Gegenstand seiner Entscheidung (§ 117 Abs. 5 VwGO). Ergänzend sei auf Folgendes hingewiesen:
a) Maßgebender Zeitpunkt für die Beurteilung, ob die Klägerin einen Anspruch auf Anerkennung der in ihrem Klageantrag aufgeführten Gesundheitsstörungen als Folge des Dienstunfalls vom 14. September 1997 hat, ist, weil es sich bei der Klage um eine Verpflichtungsklage handelt, der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung. Rechtsgrundlage für das Begehren der Klägerin sind die Vorschriften über die Unfallfürsorge, d.h. Art. 45 ff. des Bayer. Beamtenversorgungsgesetzes (BayBeamtVG).
b) Gemäß Art. 45 BayBeamtVG wird einem Beamten, der einen Dienstunfall erlitten hat, Unfallfürsorge gewährt. Ein Anspruch auf Unfallfürsorgeleistungen setzt aber immer das Vorliegen eines Dienstunfalls im Sinne von Art. 46 BayBeamtVG voraus, d.h. ein auf äußerer Einwirkung beruhendes, plötzliches, örtlich und zeitlich bestimmbares, einen Körperschaden verursachendes Ereignis, das in Ausübung oder infolge des Dienstes eingetreten ist.
Maßgeblich ist insoweit die von der Rechtsprechung entwickelte Theorie der wesentlichen Verursachung bzw. der zumindest wesentlich mitwirkenden Teilursache. Dabei sind ursächlich bzw. mitursächlich für den eingetretenen Schaden nur solche kausalen Bedingungen, die wegen ihrer besonderen Beziehung zum Erfolg bei dessen Eintritt wesentlich mitgewirkt haben. Demnach ist auch der Fall der Mitursächlichkeit anerkannt, sofern die mehreren Ur-sachen in besonderer Beziehung zum Erfolg stehen und annähernd gleichwertig sind. Wesentlich ist die Ursache, die den Schadenseintritt maßgebend geprägt hat; andere Ursachen treten demgegenüber zurück. Sind mehrere Ursachen gegeben, ist jedoch keine dieser Ur-sachen den anderen gegenüber von überragender Bedeutung, sondern sind diese Ursachen einander annähernd gleichwertig, gilt die durch den Dienst gesetzte Ursache als alleinige (wesentliche) Ursache. Löst ein Unfallereignis ein bereits vorhandenes Leiden aus oder beschleunigt oder verschlimmert dieses, so ist das Unfallereignis dann nicht wesentliche Ursache für den Körperschaden, wenn das Ereignis von untergeordneter Bedeutung gewissermaßen „der letzte Tropfen“ war, der das „Fass zum Überlaufen“ brachte. Das Unfallereignis tritt dann im Verhältnis zu der schon gegebenen Bedingung (dem vorhandenen Leiden oder der Vorschädigung) derart zurück, dass die bereits gegebene Bedingung als allein maßgeblich anzusehen ist (st.Rspr. seit BVerwG, U.v. 18.1.1967 – VI C 96.65 – ZBR 1967, 219 f.; U.v. 20.4.1967 – II C 118.64 – BVerwGE 26, 332/339 f.; so auch: BayVGH, B.v. vom 31.1.2008 – 14 B 04.73 – Rn. 20 f.).
Nicht ursächlich im Sinne des Gesetzes sind demnach die sog. Gelegenheitsursachen, d.h. solche Bedingungen, bei denen zwischen dem eingetretenen Schaden und dem Dienst eine rein zufällige Beziehung besteht. Letzteres ist beispielsweise dann der Fall, wenn die krank-hafte Veranlagung oder das anlagebedingte Leiden so leicht ansprechbar waren, dass es zur Auslösung akuter Erscheinungen keiner besonderen, in ihrer Eigenart unersetzlichen Einwirkungen bedurfte, sondern auch ein anderes, alltäglich vorkommendes Ereignis zum selben Erfolg geführt hätte (BVerwG, B.v. 8.3.2004 – 2 B 54/03 – Buchholz 239.1 § 31 BeamtVG Nr. 13; vgl. zum Ganzen: Plog/Wiedow, BBG, Stand: November 2015, Rn. 75 ff. zu § 31 BeamtVG). In diesem Zusammenhang führt das Bundesverwaltungsgericht, das sich bereits in seinem Urteil vom 20. Mai 1958 (BVerwGE 7, 48/49 f.) der haftungsbeschränkenden, auf Entscheidungen des Reichsversicherungsamts bzw. des Reichsversicherungsgerichts beruhenden Rechtsprechung des Bundessozialgerichts in Bezug auf die Haftung für Betriebsunfälle (U.v. 14.7.1955 – 8 RV 177/54 – NJW 1956, 118, 439; so auch für Dienstunfälle: BGH, U.v. 20.9.1956 – III ZR 79/55 – NJW 1957, 223) angeschlossen hatte, weiter aus (B.v. 8.3.2004 a.a.O.): „Der im Dienstunfallrecht maßgebende Ursachenbegriff soll zu einer dem Schutzbereich der Dienstunfallfürsorge entsprechenden sachgerechten Risikoverteilung führen. Der Dienstherr soll nur die spezifischen Gefahren der Beamtentätigkeit tragen und mit den auf sie zurückzuführenden Unfallursachen belastet werden. Dem Beamten sollen dagegen diejenigen Risiken verbleiben, die sich aus anderen als dienstlichen Gründen, insbesondere aus persönlichen Anlagen, Gesundheitsschäden und Abnutzungserscheinungen ergeben.“
Dabei müssen alle Tatbestandsvoraussetzungen für eine Dienstunfallanerkennung bzw. die geltend gemachten Folgen zur Überzeugung der Behörde und des Gerichts vorliegen. Der Beamte trägt das Feststellungsrisiko, dass die behauptete Schädigungsfolge wesentlich auf den Dienstunfall und nicht etwa auf eine anlagebedingte Konstitution zurückzuführen ist (st.Rspr. vgl. nur: BayVGH, B.v. 31.1.2008 – 14 B 04.73 – Rn. 20 f.; BVerwG, U.v. 23.5.1962 – VI C 39.60 – BVerwGE 14, 181; BVerwG, U.v. 21.10.1964 – VI C 132.61 – Buchholz 232.1 § 135 BBG Nr. 22; so auch: Plog/Wiedow, a.a.O., Rn. 225 ff. zu § 31 BeamtVG).
Gemessen daran liegen hier die genannten Anforderungen für die Anerkennung der von der Klägerin in Nr. 2 ihres in der mündlichen Verhandlung vom 22. November 2016 modifizierten Klageantrags vom 24. Oktober 2013 aufgeführten Gesundheitsstörungen als Folgen des Dienstunfalls vom 14. September 1997 nicht vor.
Zwar hat sich der Vorfall am 14. September 1997 unstreitig während des Dienstes zugetragen. Allein dieser Umstand verhilft der Klage aber nicht zum Erfolg, weil die notwendige Kausalität zwischen dem Dienstunfallereignis und den im Klageantrag vom 24. Oktober 2013 – in seiner in der mündlichen Verhandlung vom 22. November 2016 leicht geänderten Fassung – im Einzelnen aufgeführten gesundheitlichen Beschwerden, deren Anerkennung als Dienstunfallfolgen die Klägerin hier begehrt, fehlt. Denn der streitgegenständliche Vorfall vom 14. September 1997 hat diese Gesundheitsstörungen nicht hervorgerufen, auch nicht im Sinn einer wesentlich mitwirkenden Teilursache. Auch eine wesentliche Verschlimmerung möglicherweise bereits vorbestehender Leiden ist nicht kausal auf dieses Geschehnis zurückzuführen.
Das steht zur Überzeugung der Kammer fest aufgrund der vom Gericht in Auftrag gegebenen Gutachten und zwar dem am 13. Juli 2015 von der leitenden Ärztin Dr. Ba … erstellten unfallchirurgischen Sachverständigengutachten und dem am 21. Juli 2016 von der leitenden Ärztin Dr. F … gefertigten neurologischen Gutachten.
Beide Gutachten, welche auf einer umfassenden und nicht nur einseitigen, allein auf Angaben des Beklagten beruhenden Auswertung aller, d.h. auch den vom Ehemann der Klägerin in den Verwaltungsverfahren sowie von der Klägerin im Klageverfahren vorgelegten ärztlichen Attesten und Befundberichten basieren, sind in sich stimmig, überzeugend und werfen keine Zweifelsfragen auf, die durch die Einschaltung weiterer Gutachter geklärt werden müssten. Zweifel an der fachlichen Kompetenz der Gutachterinnen sind weder vorgetragen noch sonst ersichtlich. Aus den Gutachten, den aufgrund der Einwendungen der Klägerseite vom 12. Oktober 2016 erstellten ergänzenden Stellungnahmen der Gutachterinnen sowie den gleichfalls überzeugenden Erläuterungen der Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung, die ebenso wie das Gutachten von der Klägerseite nicht substantiiert in Frage gestellt wurden, ergibt sich in einer Gesamtschau folgendes Bild:
Im Hinblick auf die von der Klägerin geltend gemachten orthopädischen Dienstunfallfolgen geht die Sachverständige Dr. Ba … überzeugend und in sich widerspruchsfrei davon aus, dass sich zwischen dem Geschehnis vom 14. September 1997 und den vom Ehemann der Klägerin geklagten Gesundheitsstörungen auf dem orthopädischen Fachgebiet kein hinreichend wahrscheinlicher Kausalzusammenhang herstellen lässt. Somit war das Geschehen nicht geeignet, die vom Ehemann der Klägerin geklagten Beschwerden allein bzw. wesentlich zu verursachen. Im Einzelnen hat die Sachverständige überzeugend und nachvollziehbar dargelegt, dass sich den vorliegenden Befunden eindeutig Anhaltspunkte für eine degenerative Vorschädigung der Lendenwirbelsäule des Ehemanns der Klägerin entnehmen lassen. So weist die Sachverständige darauf hin (S. 14 des Gutachtens vom 13.7.2015), dass der Ehemann der Klägerin bereits im April 1985 über Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule geklagt hatte. Diese Angabe ist dem für das Sozialgericht Bayreuth erstellten medizinischen Gutachterin von Dr. R … vom 16. Juni 2008 zu entnehmen (Bl. 122/124 der Beiakte VIII). Darüber hinaus hat die Sachverständige überzeugend und nachvollziehbar herausgearbeitet, dass das ihr vorliegende, vom Krankenhaus H … W … am 13. Januar 1991 erstellte Röntgenbild „bei sechs Lendenwirbelkörpern erhebliche degenerative Verschleißerscheinungen, insbesondere zwischen L5/L6 mit spitzzipfeligen ventralen Knochenausziehungen an der Deckplatte von LWK 6 und einer Grundplatte von LWK 5“ zeigt (S. 11 des Gutachtens vom 13.7.2015). Diese Feststellung lässt sich auch aus den Aufnahmen der am 13. März 1991 ebenfalls vom Krankenhaus H … W … durchgeführten Kernspintomographie ableiten. Danach zeigt sich eine Facettengelenksarthrose zwischen C4/C5 und zwischen C5/C6 sowie Bandscheibenvorwölbungen in beiden Wirbelsäulenabschnitten (ebda.). Demnach waren beim Ehemann der Klägerin bereits im Jahr 1991 degenerativ bedingte, knöcherne Ausziehungen im Bandscheibenfach L5/L6 sowie eine Bandscheibenvorwölbung vorhanden; zudem bestand zu dieser Zeit auch eine Einengung des Spinalkanals, d.h. eine sog. Spinalkanalstenose (S. 16 des Gutachtens vom 13.7.2015). Diese durch bildgebende Verfahren bestätigten Befunde decken sich im übrigen auch mit den nur schriftlich vorliegenden Befundberichten. So weist der frühere Hausarzt, Dr. W …, in seiner Bescheinigung vom 13. März 2012 darauf hin, dass sich der Ehemann der Klägerin seit 1994 – und somit rund drei Jahre vor dem streitgegenständlichen Dienstunfall – wegen Bandscheibenvorfällen in seiner ärztlichen Behandlung befunden habe (Bl. 818 der Beiakte IV).
Ebenfalls überzeugend und nachvollziehbar hat die Sachverständige dargelegt, dass das Unfallereignis vom 14. September 1997 nicht geeignet war, einen traumatischen Bandscheibenvorfall herbeizuführen. Sie hat ausgeführt, dass nur sog. Hochrasanztraumen, d.h. ein Sturz aus großer Höhe oder ein Herausschleudern aus dem Auto, Auslöser eines solchen Bandscheibensvorfalls sein können (S. 3 der Niederschrift vom 22.11.2016). Ein solches Unfallgeschehnis liegt hier unabhängig davon, ob man der handschriftlichen Dienstunfallmeldung vom 15. September 1997 (Bl. 61 der Beiakte III) oder der nur geringfügig hiervon abweichenden maschinenschriftlichen Dienstunfallmeldung vom 2. Oktober 1997 (Bl. 65 der Beiakte III) folgt, ohne jeden Zweifel nicht vor. Zudem hat die Sachverständige überzeugend und unwidersprochen vorgetragen, dass ein solcher traumatischer Bandscheibenvorfall zum einen den Nachweis knöcherner bzw. ligamentärer Begleitverletzungen der angrenzenden Wirbelkörper oder zumindest der den betreffenden Abschnitt der Wirbelsäule begleitenden Muskel- und Bandstrukturen voraussetzt. Zum anderen ist ein solcher Bandscheibenvorfall immer von einem starken, sofort einsetzenden Schmerz begleitet (S. 16 f. des Gutachtens vom 13.7.2015; S. 4 der Niederschrift vom 22.11.2016).
Überzeugend weist die Sachverständige darauf hin, dass in der Zeit unmittelbar nach dem Dienstunfall vom 14. September 1997 von ärztlicher Seite keine Beschwerden im Bereich der Lendenwirbelsäule dokumentiert wurden, sondern dass der Ehemann der Klägerin im Herbst 1997 sogar wieder seine Arbeit aufgenommen hatte (S. 15 des Gutachtens vom 13.7.2015). Erst im Dezember 1997 begann demnach wieder eine Phase der Arbeitsunfähigkeit, der sich die Operation des Bandscheibenvorfalls anschloss (S. 15 f. des Gutachtens vom 13.7.2015).
Diese Einschätzung deckt sich im übrigen auch mit den Feststellungen des Hausarztes, Dr. W …, der in seinem zwei Tage nach dem Dienstunfall erstellten Bericht vom 16. September 1997 als Beschwerden lediglich „Kopfschmerzen, Schwindel, Nasenbeinschmerz“ konstatiert hat (Bl. 74 der Beiakte III). Dementsprechend hat der Hausarzt – wie die Sachverständige überzeugend ausführt – aufgrund fehlender Beschwerden auch weder eine erweiterte Diagnostik (CT oder Kernspintomographie) veranlasst (S. 17 des Gutachtens vom 13.7.2015), noch die bei einem traumatischen Bandscheibenvorfall zwingend gebotene Verabreichung effektiver, d.h. über die Wirkung sog. peripherer Schmerzpräparate wie z.B. Ibuprofen oder Paracetamol hinausgehender Schmerzmittel veranlasst (S. 4 der Niederschrift vom 22.11.2016). In diesem Sinne ist schließlich auch der Bescheinigung des Hausarztes vom 13. März 2012 zu entnehmen, die „Erkrankung eskalierte im Dezember 1997“ (Bl. 818 der Beiakte IV).
Die von der Klägerin im Schriftsatz vom 12. Oktober 2016 sowie in der mündlichen Verhandlung erhobenen Einwände hat die Sachverständige in ihrem Schreiben vom 26. Oktober 2016 sowie insbesondere auch durch ihre Ausführungen in der mündlichen Verhandlung überzeugend und nachvollziehbar ausgeräumt.
So hat sie den Einwand der Klägerin, man habe ihren Ehemann nach dem Unfall seitens des Klinikums B … mit starken Schmerzmedikamenten, die sie nicht mehr benennen könne, nach Hause entlassen (S. 4 der Niederschrift vom 22.11.2016), mit dem Hinweis entkräftet, es sei nach ihrer Einschätzung nicht vorstellbar, weil die ärztliche Fürsorgepflicht verletzend, dass ein Patient vom Krankenhaus mit starken Schmerzmitteln einfach so nach Hause entlassen werde. Denn bei einem traumatischen Bandscheibenvorfall müsse man über die Verabreichung zumindest von Mitteln wie Novalgin oder über die Verabreichung von schmerzlindernden Infusionen nachdenken (S. 5 der Niederschrift vom 22.11.2016).
So hat die Sachverständige die gegen ihre offenkundig auf den Bericht des Krankenhauses H … W … an den Hausarzt, Dr. W …, vom 14. März 1991 sowie das CT vom 13. März 1991 bezogene Feststellung, zum damaligen Zeitpunkt sei den behandelnden Ärzten offensichtlich nicht bekannt gewesen, dass der Ehemann der Klägerin – abweichend vom Normbefund mit fünf Lendenwirbelkörpern – sechs Lendenwirbelkörper gehabt habe (S. 13 des Gutachtens vom 13.7.2015), gerichteten Einwendungen der Klägerseite, überzeugend wiederlegt (S. 3 der Niederschrift vom 22.11.2016). Ihre Einschätzung deckt sich zum einen mit der Erklärung der Klägerin, wonach ihr Ehemann nur ein einziges Mal an der Wirbelsäule operiert worden sei, und zwar im Januar 1998 (ebda.). Zum anderen lässt sich aus den vorliegenden Befunden ableiten, dass die behandelnden bzw. befundenden Ärzte zwar übereinstimmend von nur einer Bandscheibenoperation ausgehen, diese aber entweder im Segment L4/5 verorten (so z.B. Dr. G …, Bericht vom 30.12.2008, Bl. 97 der Beiakte I; Dr. W …, Bericht vom 10.3.1998, Bl. 28 der Beiakte VIII; Dr. C …, Bericht vom 17.11.2009, Bl. 451 der Beiakte I) oder im Bereich L5/6 (so z.B. Dr. R …, Gutachten vom 16.6.2008, Bl. 122/124 der Beiakte VIII; Prof. Dr. B …, OP-Bericht vom 23.1.1998, Bl. 227 ff. der Gerichtsakte, Band 1).
Den weiteren Hinweisen der Klägerseite, die Sachverständige könne nicht behaupten, dass der Ehemann der Klägerin nicht auch über Rückenschmerzen geklagt habe (S. 2 des Schriftsatzes vom 12.10.2016), dass der Hausarzt, Dr. W …, den „Bandscheibenvorfall 4/5“ mit Spritzen und medikamentös behandelt habe (ebda.) und dass „vom (…) 21.12.1997 – 30.12.1997 massive Beschwerden vorhanden“ gewesen seien (S. 3 des Schriftsatzes vom 12.10.2016), hat die Sachverständige ebenfalls zutreffend gewürdigt und plausibel entkräftet. Sie hat insbesondere überzeugend dargelegt, dass es allein Aufgabe ihres Gutachtens sei, die objektiv vorliegenden Anknüpfungstatsachen zu werten (S. 2 des Schreibens vom 26.10.2016).
Schließlich ist die Sachverständige insbesondere dem Vorwurf, sie erwähne u.a. das CT vom 15. September 1997 nicht (S. 3 des Schriftsatzes vom 12.10.2016), mit dem überzeugenden Hinweis entgegengetreten, dass am 15. September 1997 kein CT der Wirbelsäule gefertigt worden sei (S. 3 des Schreibens vom 26.10.2016). Tatsächlich finden sich in den Akten ausschließlich Hinweise auf ein am 15. September 1997 von Dr. H … gefertigtes CT des Schädels (Bl. 32 der Gerichtsakte, Band 1), jedoch in dem gesamten, mehrbändigen, mehr als 60 ärztliche Befundberichte, Atteste oder Stellungnahmen umfassenden Aktenkonvolut keine Hinweise auf eine am 15. September 1997 durchgeführte CT-Untersuchung an der Wirbelsäule.
Die dargelegten medizinische Feststellungen der Sachverständigen decken sich nicht zuletzt auch mit den vorliegenden amtsärztlichen Befunden. So ergibt sich aus dem Gutachten des Gesundheitsamts vom 14. Dezember 2009, welches u.a. auch auf einer Untersuchung des Ehemanns der Klägerin beruhte, dass ein chronisches Schmerzsyndrom der Wirbelsäule mit massiver Einschränkung der Beweglichkeit sowie weitere degenerative Veränderungen des Bewegungsapparates vorlägen (Bl. 163 ff. der Beiakte VIII). Gleiches ergibt sich aus dem Bericht des Gesundheitsamts vom 2. August 2010 (Bl. 395 ff. der Beiakte I), wonach degenerative Veränderungen im Bereich des gesamten Stützapparates und in der Folge ausgeprägte strukturelle Veränderungen an der Halswirbelsäule sowie der Lendenwirbelsäule zu konstatieren seien.
Bezüglich der von Klägerseite geltend gemachten neurologischen Folgen des Dienstunfalls vom 14. September 1997 führt die Sachverständige Dr. F … überzeugend aus, dass sich zwischen dem Unfallgeschehen und den vom Ehemann der Klägerin geklagten Gesundheitsstörungen auf dem neurologischen Fachgebiet kein hinreichend wahrscheinlicher Kausalzusammenhang herstellen lässt. Somit war das Geschehen nicht geeignet, die vom Ehemann der Klägerin geklagten Beschwerden allein bzw. wesentlich zu verursachen. Im Einzelnen hat die Sachverständige in ihren schriftlichen Ausführungen überzeugend ausgeführt, dass in der gesamten, unmittelbar nach dem Dienstunfall vom 14. September 1997 einsetzenden Dokumentation, insbesondere auch in der vom Ehemann der Klägerin selbst verfassten Unfallanzeige, keine anderweitigen neurologischen Symptome, insbesondere keine Sprach- und Sprechstörungen vermerkt seien (S. 22 des Gutachtens vom 21.7.2016). Sie stellt ferner unwidersprochen klar, dass im MRT vom 23. Dezember 1997 keine Traumafolgen nachweisbar gewesen seien, die auf den Dienstunfall vom 14. September 1997 hätten zurückgeführt werden können (S. 23 des Gutachtens vom 21.7.2016). Zudem schließt sie die von der Klägerseite angesprochene Möglichkeit eines sog. zweizeitigen Infarktgeschehens, d.h. eines durch den Dienstunfall am 14. September 1997 ausgelösten und sich im Dezember 1997 manifestierenden Hirninfarkt überzeugend und widerspruchsfrei aus. Sie weist in diesem Zusammenhang zunächst darauf hin, dass das am 15. September 1997 durchgeführte CT des Schädels unauffällig gewesen sei und dass sich insbesondere keine Blutauflagerungen hätten nachweisen lassen. Auch seien keine weiteren Traumafolgen dokumentiert. Diese Einschätzung werde durch die im Dezember durchgeführte Kernspintomographie bestätigt (S. 23, 25 des Gutachtens vom 21.7.2016).
Darüber hinaus schließt die Sachverständige die Annahme eines traumatisch bedingten, d.h. durch den Unfall vom 14. September 1997 verursachten Schlaganfalls aus (S. 23 f. des Gutachtens vom 21.7.2016). Zum einen weist sie überzeugend darauf hin, dass zwar auch ein Sturz einen Hirninfarkt auslösen könne, wenn z.B. jemand mit dem Hals auf einen spitzen oder stumpfen Gegenstand stürze oder wenn es infolge eines Bruches eines Röhrenknochens (z. B. Oberschenkelknochen) zu einer sogenannten Fettembolie komme; solche Gefäßverletzungen (Dissektionen) müssten dann aber auch nachgewiesen sein. Das sei hier nicht der Fall (S. 24 des Gutachtens vom 21.7.2016; S. 6 der Niederschrift vom 22.11.2016). Zum anderen stellt die Sachverständige nachvollziehbar heraus, dass Schlaganfälle bei traumatisch bedingten Gefäßverletzungen zwar meistens nicht unmittelbar nach dem Trauma aufträten, dass die Latenz zwischen Trauma und Schlaganfall aber in der Regel einige Tage bis wenige Wochen betrage. Ein – wie hier – drei Monate nach dem Unfallereignis auftretender Hirninfarkt – zudem ohne Nachweis einer Gefäßdissektion – sei mit dem Trauma nicht in Zusammenhang zu bringen (S. 24 des Gutachtens vom 21.7.2016).
Demgegenüber hat die Sachverständige überzeugend und widerspruchsfrei dargelegt, dass der im Dezember 1997 dokumentierte Schlaganfall unfallunabhängig drei Monate nach dem Trauma spontan und schicksalhaft entstanden sei; Ursachen hierfür seien die beim Ehemann der Klägerin hinreichend dokumentierten vaskulären Risikofaktoren wie Nikotin und Hypercholesterinämie. So sei es bereits im Jahr 1990 zu einem Infarkt im Bereich des Kleinhirns gekommen (S. 24 des Gutachtens vom 21.7.2016). Diese Einschätzung, insbesondere die Annahme der von der Sachverständigen erwähnten vaskulären Risikofaktoren, lässt sich zweifelsfrei auch auf die von der Klägerseite vorgelegten Befundberichte stützen.
Auf die Rüge der Klägerseite (S. 6 des Schriftsatzes vom 12.10.2016) hin hat die Sachverständige zwar eingeräumt, dass sich den vorliegenden Befundberichten – entgegen der Feststellung in ihren schriftlichen Ausführungen (S. 24 des Gutachtens vom 21.7.2016) – tatsächlich keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer „koronaren Herzerkrankung“ beim Ehemann der Klägerin entnehmen ließen, sondern dass es eigentlich „hypertensive Herzerkrankung“ heißen müsse (S. 12 f. des Schreibens vom 8.11.2016). Eine solche hypertensive Herzerkrankung, deren Vorliegen beim Ehemann der Klägerin in dem Bericht des Kardiologen Dr. Ho … vom 1. Oktober 2008 zweifelsfrei dokumentiert (Bl. 132 der Beiakte III) ist, weise auf einen über viele Jahre bestehenden, unerkannten oder nicht ausreichend behandelten Bluthochdruck hin. Bluthochdruck sei aber – neben Nikotinabusus und Hypercholesterinämie – ein deutlicher Gefäßrisikofaktor (S. 13 des Schreibens vom 8.11.2016).
Ferner sind beispielsweise dem sechs Monate vor dem Unfallereignis erstellten Bericht des behandelnden Hausarztes, Dr. W …, vom 10. März 1997 (Bl. 89 der Gerichtsakte, Band 2) in Bezug auf den Ehemann der Klägerin folgende Risikofaktoren zu entnehmen: „Übergewicht, Nikotin, Fettstoffwechselstörung“. In der Rubrik „Familienanamnese“ heißt es weiter: „Hypertonie und Schlaganfall (Mutter)“. Schließlich befindet sich im Abschnitt „Allgemeines“ dort der Hinweis: „Nikotin: 20 Zigaretten; regelmäßiger Alkoholgenuss: 1 Bier“. Diese Angaben decken sich im übrigen auch mit dem Bericht über die in der Klinik H … B … nach der Bandscheibenoperation durchgeführte stationäre Behandlung (3.2.-23.2.1998), in dem als Diagnosen u.a. eine Fettstoffwechselstörung sowie ein Leberparenchymschaden aufgeführt sind (Bericht Dr. T … vom 26.2.1998, Bl. 37 ff. der Beiakte VIII). Ferner sind dort als Anamnese u.a. ein „leichter Schlaganfall“ mit Sprechstörungen vom 16. Dezember 1997 ohne Lähmungen sowie eine bekannte Hypercholesterinämie angeführt. Ferner heißt es dort: „Nikotin: Abstinent seit 30.12.97. Alkohol: 1-2 Flaschen Bier/tgl. M“.
In der mündlichen Verhandlung hat die Sachverständige ihre Feststellungen zum Vorliegen vaskulärer Risikofaktoren überzeugend untermauert. So hat sie (S. 8 der Niederschrift vom 22.11.2016) auf problematische bzw. grenzwertige Blutdruckwerte des Ehemanns der Klägerin hingewiesen. Ihre Angaben decken sich vollumfänglich mit den vorliegenden Befundberichten (Bericht von Prof. Dr. G … vom 13.1.1998, Bl. 32 f. der Beiakte VIII; Bericht Dr. T … vom 26.2.1998, Bl. 37 ff. der Beiakte VIII; Aktennotiz von Dr. K … vom 14.4.1998, Bl. 778 der Beiakte IV).
Die Gutachterin hat ferner – entgegen den Einwendungen der Klägerseite (S. 4 f. des Schriftsatzes vom 12.10.2016) – das Vorliegen eines Leberschadens überzeugend dargelegt. So hat sie ausgeführt, dass die Diagnose eines Leberparenchymschadens zwar in dem Bericht des Hausarztes Dr. W … vom 10. März 1998 nicht ausdrücklich aufgeführt sei, dass aber den dort wiedergegebenen Laborbefunden erhöhte Transaminasen zu entnehmen seien, die einen solchen Leberschaden belegten. Zudem sei dort als sonographischer Befund eine Fettleber festgehalten (S. 5 der Stellungnahme vom 8.11.2016; S. 9 der Niederschrift vom 22.11.2016). Diese Angabe deckt sich im übrigen auch mit dem Bericht der Klinik H* … vom 26. Februar 1998 (Bl. 37 ff. der Beiakte VIII).
Soweit sich die Klägerseite gegen die Annahme mikroangiopathischer Veränderungen u.a. durch Nikotinabusus und durch erhöhte Fettwerte (insbesondere Cholesterin) wendet, ist dem die Sachverständige mit ihrer schriftlichen Stellungnahme vom 8. November 2016 (vgl. dort S. 7) und ihren Ausführungen in der mündlichen Verhandlung überzeugend und widerspruchsfrei entgegengetreten (S. 8 f. der Niederschrift vom 22.11.2016). Ihre Einschätzung deckt sich vollumfänglich mit den bereits oben erwähnten Feststellungen des damals behandelnden Hausarztes, Dr. W …, vom 10. März 1997 (Bl. 89 der Gerichtsakte, Band 2) und dem durch Dr. T … erstellten Bericht der Klinik H … vom 26. Februar 1998 über die stationäre Behandlung des Ehemanns der Klägerin vom 3. bis 23. Februar 1998 (Bl. 37 ff. der Beiakte VIII). Im Hinblick auf den Einwand der Klägerin in der mündlichen Verhandlung, ihr Ehemann habe bereits 1991 aufgehört zu rauchen, heißt es dort ausdrücklich: „Nikotin: abstinent seit 30.12.1997“. Zudem hat die Sachverständige überzeugend darauf hingewiesen, dass die Risikofaktoren auch nach einer Beendigung des Nikotinkonsums weiter bestehen bleiben, weil aufgrund des vorherigen Nikotinkonsums Gefäßveränderungen eingetreten seien (S. 8 der Niederschrift vom 22.11.2016).
Schließlich hat die Gutachterin nachvollziehbar dargelegt, dass der Einschätzung von Prof. Dr. O …, Chefarzt der Klinik für Neurologie, Klinikum B …, in seinen Berichten vom 21. Oktober 2011 (Bl. 780 ff. der Beiakte IV) und vom 6. März 2012 (Bl. 783 ff. der Beiakte IV) nicht zu folgen sei. Sie weist zutreffend zum einen darauf hin, dass sich Prof. Dr. O … allein auf die Angaben des Ehemanns der Klägerin, nicht aber auf die objektive Aktenlage stütze. Zum anderen stellt sie – gestützt auf die vorliegende Dokumentation – überzeugend darauf ab, dass vorliegend gerade nicht von „einer gewissen Schwere des Schädel-Hirn-Traumas“ auszugehen ist.
In diesem Zusammenhang stellt die Gutachterin überzeugend und nachvollziehbar heraus, dass die Symptome „Kopfschmerzen“ und „Schwindel“ nur dem Bericht des Hausarztes vom 16. September 1997 (Bl. 74 der Beiakte III) dokumentiert seien, nicht aber in den neurologischen Befunden im Januar 1998 (S. 25 des Gutachtens vom 21.7.2016). Erstmals sei dem radiologischen Befundbericht des Krankenhauses H … W … vom 17. Januar 2002 (Bl. 82 der Beiakte VIII) als Beschwerde die klinische Angabe „erneut Schwindel“ zu entnehmen (S. 26 des Gutachtens vom 21.7.2016). Dieser „Decrescendo-Verlauf“ – so die Sachverständige – deckt sich nach ihren unwidersprochen gebliebenen Angaben mit dem typischen, posttraumatischen Abläufen nach leichten Schädel-Hirn-Traumen sowie nach bloßen Schädelprellungen (S. 26 des Gutachtens vom 21.7.2016). Als mögliche andere Auslöser für die vom Ehemann der Klägerin wieder seit dem Jahr 2002 geklagte Schwindelsymptomatik führt die Sachverständige (ebda.) neben einem – wie oben dargelegt – beim Ehemann der Klägerin dokumentierten Bluthochdruck auch ein von Dr. Ra …, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, in seinem Bericht vom 28. Februar 2002 dokumentiertes somatisiert-depressives Syndrom (Bl. 86 der Beiakte VIII) auf.
Durchgreifende Argumente, die geeignet sein könnten, diese gutachterlichen Feststellungen zu erschüttern, sind nicht zu erkennen. Die Klägerseite ist weder dem Gutachten noch den Ausführungen der Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung substantiiert entgegengetreten. Die weiteren Einwendungen der Klägerseite im Schriftsatz vom 12. Oktober 2016 hat die Sachverständige durch die Ausführungen in ihrer ergänzenden gutachterlichen Stellungnahme vom 8. November 2016 sowie ihre Erläuterungen in der mündlichen Verhandlung überzeugend entkräftet.
So hat die Sachverständige deutlich gemacht, an welchen Stellen ihres Gutachtens sie lediglich vorliegende Arztberichte wiedergegeben hat (S. 3 der Stellungnahme vom 8.11.2016). Sie hat ferner nachvollziehbar und überzeugend dargelegt, dass sie sich hinsichtlich des Berichts der Klinik H … vom 26. Februar 1998 auf die chefärztliche Unterschrift und nicht (auch) auf die Unterschrift des diesen Bericht mitverfassenden Stationsarztes bezogen habe (S. 5 der Stellungnahme vom 8.11.2016).
Die von der Sachverständigen eingeräumten Fehler – zum einen die fehlerhafte Wiedergabe eines Datums (S. 7 f. der Stellungnahme vom 8.11.2016), zum anderen die fehlerhafte Annahme einer „koronaren“ an Stelle einer „hypertensive“ Herzerkrankung (S. 12 f. der Stellungnahme vom 8.11.2016) – sind marginaler Natur, angesichts der Materialfülle dieses Verfahrens zu vernachlässigen und nicht einmal ansatzweise geeignet, die Ausführungen der Sachverständigen grundlegend in Zweifel zu ziehen.
Aus den Ausführungen beider Sachverständigen ergibt sich für das Gericht auch eindeutig und nachvollziehbar, dass es auf die von der Klägerseite während des gesamten Verwaltungs- und Gerichtsverfahrens gerügten minimalen Differenzen im Hinblick auf den Ablauf des Sturzes zwischen der vom Ehemann der Klägerin handschriftlich verfassten Dienstunfallanzeige vom 15. September 1997 („mit dem Oberkopf gegen die Toilettentür prallte“) und der vom Beklagten erstellten maschinenschriftlichen Fassung vom 2. Oktober 1997 („mit dem Oberkopf gegen die Toiletten hin prallte“), nicht ankommt, so dass auch in diesem Punkt keine weitere Sachverhaltsaufklärung veranlasst war. Denn – selbst wenn man hier substantielle Abweichungen sähe – führte auch die Zugrundelegung der handschriftlichen Fassung insbesondere nicht zur Annahme einer traumatischen Bandscheibenverletzung oder eines traumatisch bedingten Hirninfarkts.
Nach alledem hat das Gericht die Überzeugung gewonnen, dass das Ereignis vom 14. September 1997 nicht ursächlich für die von dem verstorbenen Ehemann der Klägerin geklagten Gesundheitsstörungen ist, sondern dass dieses Geschehnis – wenn überhaupt – dann allenfalls als Gelegenheitsursache und als Auslöser aufgrund anlagebedingter Krankheitsdispositionen angesehen werden kann. Aus diesem Grund hat die Klägerin weder einen Anspruch auf Anerkennung weiterer Dienstunfallfolgen noch einen Anspruch auf Neufestsetzung der Minderung der Erwerbsfähigkeit.
2. Die Kostenentscheidung stützt sich auf § 154 Abs. 1 VwGO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 Abs. 1 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11, § 711 ZPO.
3. Gründe für eine Zulassung der Berufung durch das Verwaltungsgericht nach § 124 Abs. 1, § 124a Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 124 Abs. 2 Nrn. 3 und 4 VwGO liegen nicht vor.