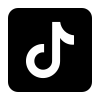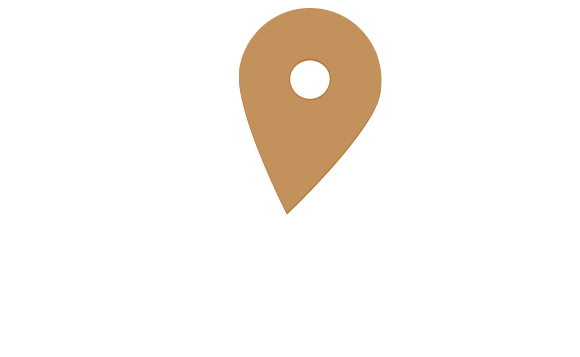Aktenzeichen L 19 R 65/16
Leitsatz
Psychische Störungen, welche einer ambulanten psychotherapeutischen Behandlung und einer geänderten Medikation bedürfen, aber Erlebnis- und Gestaltungsfähigkeit nicht eingeschränken, begründen kein rentenberechtigendes herabgesetztes Leistungsvermögen. (Rn. 31) (redaktioneller Leitsatz)
Verfahrensgang
S 12 R 1058/14 2016-01-19 GeB SGNUERNBERG SG Nürnberg
Tenor
I.
Auf die Berufung der Beklagten hin wird der Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Nürnberg vom 19.01.2016 aufgehoben und die Klage gegen den Bescheid der Beklagten vom 10.09.2014 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 17.10.2014 abgewiesen.
II.
Außergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III.
Die Revision wird nicht zugelassen.
Gründe
Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung der Beklagten ist zulässig (§§ 143, 144, 151 Sozialgerichtsgesetz – SGG -). Die Berufung ist auch begründet. Das SG hat zu Unrecht mit Gerichtsbescheid vom 19.01.2016 der Klägerin einen Anspruch auf Gewährung einer Rente wegen voller Erwerbsminderung auf Zeit zuerkannt. Eine quantitative Minderung der Leistungsfähigkeit der Klägerin für Tätigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes auf unter 6 Stunden täglich unter Beachtung qualitativer Leistungseinschränkungen ist nicht nachgewiesen.
Gemäß § 43 Abs. 1 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI) haben Versicherte bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze Anspruch auf Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung, wenn sie 1. teilweise erwerbsgemindert sind, 2. in den letzten 5 Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung 3 Jahre Pflichtbeiträge für eine versicherte Tätigkeit oder Beschäftigung haben und 3. vor Eintritt der Erwerbsminderung die allgemeine Wartezeit erfüllt haben.
Teilweise erwerbsgemindert sind gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 SGB VI Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit außerstande sind, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes für mindestens 6 Stunden täglich erwerbstätig zu sein. Einen Anspruch auf Rente wegen voller Erwerbsminderung haben nach § 43 Abs. 2 Satz 2 SGB VI Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit außerstande sind, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens 3 Stunden täglich erwerbstätig zu sein.
Zur Überzeugung des Senats steht fest, dass der Nachweis einer quantitativen Minderung der Erwerbsfähigkeit der Klägerin infolge der vorliegenden gesundheitlichen Einschränkungen nicht erbracht wurde. Zwar bestehen bei der Klägerin psychische Erkrankungen, die die Klägerin in der Vergangenheit auch hat behandeln lassen, insbesondere durch ambulante Behandlungsmaßnahmen, Einnahme von Johanniskrautpräparaten und durch dreimalige stationäre Behandlungen. Gleichwohl führen die daraus resultierenden Leistungseinschränkungen nicht zu einer Einschränkung der zeitlichen Belastbarkeit der Klägerin, sondern nur zu Leistungseinschränkungen qualitativer Art im Hinblick auf die Schwere der Tätigkeit und die psychische Belastbarkeit. Ein Absinken des Leistungsvermögens auf unter 6 Stunden täglich ist noch nicht gegeben. Der Senat stützt seine Überzeugung auf das eingeholte Sachverständigengutachten von Dr. G. vom 19.02.2017, der zu dem gleichen Ergebnis gelangt ist wie der Sachverständige Dr. N. im Rentenverfahren und eine mindestens 6-stündige Einsatzfähigkeit der Klägerin für Tätigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes unter Beachtung qualitativer Leistungseinschränkungen annimmt. Demgegenüber ist die Sachverständige Dr. W. in ihrem Gutachten vom 01.05.2015 zu einem unter dreistündigen Leistungsvermögen der Klägerin ab Rentenantragstellung gelangt, allerdings unter Annahme von Behandlungsoptionen.
Festzuhalten ist, dass alle drei im Verfahren tätig gewordenen Sachverständige den wesentlichen Aspekt zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Klägerin in der posttraumatischen Belastungsstörung und der rezidivierenden depressiven Erkrankung sowie der chronischen Schmerzstörung mit psychischen und somatischen Faktoren sehen, lediglich die Frage des Ausmaßes der Einschränkungen wird von den Sachverständigen unterschiedlich beurteilt. Dr. W. ging zusätzlich vom Vorliegen einer Angst- und Panikstörung sowie von einer Agoraphobie aus, für die Dr. G. keinerlei Anhaltspunkte sehen konnte.
Dr. G. weist in seinem Gutachten vom 19.02.2017 darauf hin, dass sich aufgrund der durchgeführten Testverfahren lediglich Anhaltspunkte für eine rezidivierende depressive Störung gefunden hätten, die gegenwärtig gut remittiert sei. Eine schwerwiegende depressive Erkrankung konnte er überhaupt nicht erkennen. Bestätigt sah er dies auch aufgrund des Umstandes, dass eine psychiatrische Behandlung nicht durchgeführt und eine Einnahme von Psychopharmaka weder vom behandelnden Arzt noch von der Klägerin für notwendig erachtet wird. Der Prozessbevollmächtigte der Klägerin hat in diesem Zusammenhang vorgetragen, dass die Klägerin alle Medikamente ausprobiert hätte und dass aufgrund der Unverträglichkeiten schließlich nur die Behandlung mit Johanniskrautpräparaten übrig geblieben sei. Die Klägerin selbst hat aber gegenüber den Sachverständigen Dr. N., Dr. W. und Dr. G. angegeben, dass sie wohl letztmals im Jahr 2011 Psychopharmaka eingenommen habe. Im Entlassungsbericht des Klinikum A-Stadt vom 15.07.2013 ist festgehalten, dass die Klägerin entgegen der Empfehlung des Klinikums keine weitere/andere antidepressive Medikation als ihre häusliche Medikation mit Johanniskraut gewünscht habe, die fortgeführt worden sei. Als Entlassungsmedikation ist festgehalten: Johanniskraut 900 (Laif) 1-0-0, Cetirizin 10 mg 1-0-0 (aktuell während Pollenflugzeit), bei Bedarf Metamizol 500 mg max. 3x täglich. Nach ihren eigenen Angaben in der mündlichen Verhandlung vom 12.04.2017 wurde auch zwischenzeitlich kein erneuter Versuch einer medikamentösen Behandlung mit Psychopharmaka unternommen.
Dr. G. hat des Weiteren darauf hingewiesen, dass auch die Schilderung des Tagesablaufs gegen eine tiefergehende depressive Störung spreche. Die Klägerin sei in der Lage, ihren Tag zu strukturieren, ihren Haushalt zu erledigen, ihre Katzen zu versorgen. Als Hobbies habe sie angegeben, Aquarell zu malen, sie male Tiere. Sie lese, wenn auch in erster Linie Literatur, die ihr weiterhelfe, z. B. über die posttraumatische Belastungsstörung, aber auch andere Literatur. Die Klägerin sei offensichtlich in der Lage, ihr Haus zu verlassen, Einkäufe zu erledigen, Arztbesuche vorzunehmen, Nachbarn zu treffen. Sie sei in der Vergangenheit in der Lage gewesen, den Haushalt mit drei Kindern zu bewältigen und auch noch eine Ausbildung zur Pflegehilfskraft aufzunehmen. Sie war auch in der Lage eine neue Beziehung aufzubauen, sie hat ihren Ehemann im Jahr 2004 kennen gelernt, ist über Jahre zu ihm nach A-Stadt gependelt und ist im Jahr 2007 in das gleiche Haus mit eingezogen. Im Jahr 2013 erfolgte die Eheschließung. Die Klägerin gab in der stationären Behandlung im Klinikum A-Stadt im Jahr 2013 an, dass die neue Beziehung gut laufe, ihr Partner sei ruhig und unterstütze sie. Er habe ihr kurz vor Aufnahme in die Klinik einen Heiratsantrag gemacht, den sie angenommen habe. Die Hochzeitsreise fand in die Karibik statt, die Klägerin konnte an dieser Reise offensichtlich teilnehmen, auch wenn sie gegenüber Dr. W. und Dr. G. auf die für sie damit verbundenen psychischen Belastungen hingewiesen hat. Die bei den Sachverständigen geschilderten Tagesabläufe sind dabei durchaus vergleichbar. Die Klägerin ist grundsätzlich in der Lage, ihren Tagesablauf zu strukturieren und dies war auch in der Vergangenheit so. Sie kann und konnte ihren Haushalt versorgen, sich der Erziehung von 3 Kindern widmen, trotzdem die neue Beziehung aufbauen, eine Ausbildung zur Pflegehelferin aufnehmen und beruflich als Pflegekraft für Demenzerkrankte tätig sein. Das Arbeitsverhältnis wurde nicht wegen psychischer Überforderung durch Krankheit und Tod beendet, sondern durch den Arbeitgeber, der den Anstellungsvertrag nicht verlängerte bzw. nach Ansicht der Klägerin infolge Mobbings wegen Anzeige von Pflegemissständen und Gewalteinwirkungen auf Pflegebedürftige. Die Klägerin ist in der Lage, das Haus zu verlassen, einzukaufen, Arztbesuche zu unternehmen, sie hat Kontakt zu ihren Kindern und zu ihren Eltern, wenn wohl auch eingeschränkt. Zusammen mit der Schwiegermutter besucht sie zweimal wöchentlich ein Fitnessstudio. Sie pflegt Hobbies wie malen und lesen. Dr. G. sieht allerdings auch – wie Dr. N. und Dr. W. – eine Fixierung der Klägerin auf die vorliegende posttraumatische Belastungsstörung, die mit dem Selbstmordversuch des Exmannes der Klägerin im Jahr 2000 verbunden wird. Dr. G. hält hier in seinem Gutachten allerdings fest, dass diskrepant zu den geschilderten Belastungen die Klägerin durchaus in der Lage war, den Vorgang sehr detailliert zu beschreiben und dies auch noch ohne jegliche erkennbare emotionale oder affektive Beteiligung oder gar Entgleisung. Durchaus ungewöhnlich sei – wie auch von Dr. N. festgestellt -, dass dieses Erlebnis ca. 13 Jahre zurück lag, ehe eine diesbezügliche Traumatherapie durchgeführt wurde. Die Klägerin hat gegenüber Dr. G. auf entsprechende Nachfrage angegeben, dass sie als alleinerziehende Mutter dreier Kinder einfach habe funktionieren müssen, sie habe aber die ganzen Jahre über körperliche Beschwerden in Form von Magen-Darm-Problemen und körperlichen Schmerzen gehabt. Der Zusammenhang mit dem Trauma und der dann festgestellten posttraumatischen Belastungsstörung sei im Rahmen der ersten Therapie im Jahr 2013 „hoch gekommen“.
Dr. G. weist insoweit darauf hin, dass die Klägerin bei der Testung der Auswirkungen des Suizidversuchs den maximalen Punktwert von 59 erreicht habe, so dass eigentlich von einem schweren erlebten Trauma auszugehen sei. Die Klägerin habe alle Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung angegeben gehabt, so dass rein formal die Kriterien hierfür als erfüllt anzusehen seien. Eine wesentliche Beeinträchtigung durch diese Diagnose sei jedoch bei der Klägerin auch im Hinblick auf ihren Tagesablauf nicht festzustellen gewesen und die diesbezüglichen Beschwerdevalidierungstests (strukturierter Fragebogen simulierter Symptome und Schmerz-Situations-Skala) hätten Punktwerte gezeigt, die dafür sprächen, dass eine willkürliche Beschwerdeverdeutlichung bei der Klägerin anzunehmen sei, sich also deutliche Anhaltspunkte für eine Aggravation gezeigt hätten.
Vergleichbare Testergebnisse finden sich bei Dr. G. im Hinblick auf das Ausmaß der depressiven Erkrankung. Hier hat die Klägerin im BDI-Test einen Wert von 33 erreicht, was als subjektives Empfinden einer schweren Depression zu interpretieren ist. Die Kontrolltestung durch die Hamilton Depressionsskala brachte lediglich 9 Punkte, was bedeutet, dass im Querschnitt eine depressive Erkrankung der Klägerin nicht bzw. nicht mehr vorliegt und diese tatsächlich remittiert ist.
Festzuhalten ist ferner, dass die im Gutachten von Dr. W. festgestellten Panikattacken und die Agoraphobie von der Klägerin gegenüber dem Sachverständigen Dr. G. überhaupt nicht mehr geltend gemacht worden sind. Dr. G. weist darauf hin, dass sich aus dem Bericht des Klinikums A-Stadt vom 08.12.2014 ersehen lasse, dass der Schwerpunkt der bisherigen Behandlungen auf der Eruierung der Ursachen der körperlichen und psychischen Symptome gelegen habe und die von der Klägerin erlernten eigenverantwortlich durchführbaren Verwendungsmodule nur wenig angewandt worden seien. Wesentliche Verhaltensänderungen hätten bislang nicht erreicht werden können. Daraus folgert Dr. G. im Einklang mit Dr. N., dass das Leistungsvermögen der Klägerin qualitativ eingeschränkt ist hinsichtlich der Schwere der Arbeit sowie hinsichtlich psychisch fordernder Tätigkeiten, dass sie aber auf jeden Fall einer stützenden psychotherapeutischen Behandlung bedarf. Eine kognitive Einschränkung der Klägerin konnte er allerdings nicht sehen.
Der Senat schließt sich der Einschätzung von Dr. G. und im Ergebnis auch der Einschätzung von Dr. N. an. Beide sehen, dass die psychische Störung der Klägerin chronifiziert ist und einer kontinuierlichen psychotherapeutischen Behandlung bedürfte, um die Klägerin zu stabilisieren. Beide weisen auch darauf hin, dass eine medikamentöse Behandlung durchaus eine Besserung bringen könnte und der pauschale Hinweis auf Unverträglichkeiten von Psychopharmaka nicht ausreichend ist, um hier bestehende Behandlungspotentiale zu verneinen. Nach den eigenen Angaben der Klägerin erfolgte seit 2011 keine weitere medikamentöse Behandlung mehr, also bereits deutlich vor dem Zeitpunkt der von der Klägerin selbst angegebenen Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes im Jahr 2013. Dr. W. gibt in ihrem Gutachten vom 01.05.2015 an, dass sie ebenfalls von einer Behandlungsbedürftigkeit der Klägerin ausgeht und dass sie auch kein Ereignis benennen könne, das eine Verschlimmerung gegenüber der Einschätzung von Dr. N. begründen könnte. Dem Hinweis von Dr. N. auf die fehlende Compliance der Klägerin in Hinblick auf die Medikation hat Dr. W. grundsätzlich zugestimmt und auch die Gabe von Psychopharmaka befürwortet, weil unzweifelhaft positive Wirkung auf die rezidivierende depressive Störung als auch auf die Angsterkrankung der Klägerin zu erwarten sei. Die Hauptproblematik der Klägerin wird in der Beherrschung der Symptome der posttraumatischen Belastungsstörung und der Schmerzerkrankung gesehen, ebenso wie bei Dr. G. und Dr. N … Dr. W. geht aber im Gegensatz zu diesen beiden Sachverständigen von einer vorübergehend abgesunkenen quantitativen Leistungsfähigkeit aus, die Klägerin sei gegenwärtig den Anforderungen des allgemeinen Arbeitsmarktes nicht gewachsen, eine Verbesserung des quantitativen Leistungsvermögens wird von ihr durch eine stationäre Traumatherapie und durch ambulante psychotherapeutische Behandlung im Sinne einer Verhaltenstherapie innerhalb eines Zeitraums von 1 – 2 Jahren für möglich erachtet. Eine eingehende Begründung ihrer Beurteilung des quantitativen Leistungsvermögens der Klägerin gibt Dr. W. allerdings nicht, sie betont lediglich, dass die Intensität ihrer Befragung ein stärkeres Ausmaß der psychischen Belastungen der Klägerin erkennen lasse, als dies Dr. N. angenommen habe.
Zwischenzeitlich wurde eine weitere stationäre Behandlung in der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Klinikums A-Stadt in der Zeit vom 24.11.2015 – 05.01.2016 durchgeführt. Im Entlassungsbericht vom 22.02.2016 wurde von der Klinik festgestellt, dass die Klägerin erst im Oktober 2015 mit der Psychotherapie bei Dr. F. begonnen habe, eine ambulante Therapie 2014 im ABC des Nordklinikums sei nicht überwiegend traumaspezifisch gewesen. Bei den Schilderungen ihrer Belastung sei die Klägerin zu Beginn der Behandlung sehr passiv gewesen, trotz der mehrfachen Therapieerfahrungen mit wenig Ideen, wie sie konkrete Belastungssituationen und ihr Bedrohungsgefühl davor, alleine nach außen zu gehen, verändern bzw. darauf einwirken zu können. Die Klägerin konnte stabilisiert mit verringertem Vermeidungsverhalten entlassen werden, empfohlen wurde eine Fortsetzung der ambulanten Psychotherapie bei Dr. F., eine ambulante Behandlung in der psychiatrischen Institutsambulanz und der Besuch einer Gestaltungstherapiegruppe. Der Entlassungsbericht des Klinikums A-Stadt bestätigt damit die Notwendigkeit weiterer Behandlungen der Klägerin, ist aber zugleich auch Bestätigung der vorliegenden Inkonsistenzen, auf die die beiden Sachverständigen Dr. N. und Dr. G. hingewiesen haben. Bei den die Klägerin belastenden Erfahrungen tauchen im Entlassungsbericht des Klinikums A-Stadt überwiegend Ablehnung durch die Eltern, insbesondere der Mutter auf, erstmals ein „vermuteter sexueller Übergriff durch einen Kollegen des Vaters“, aber gerade nicht der Tod der Großmutter im Jahr 1983 sowie der Verkehrsunfall im Jahr 2005, die aber zusammen mit dem Suizidversuch des Ex-Ehemannes im Jahr 2000 in der mündlichen Verhandlung vom 12.04.2017 als maßgebende traumatisierende Ereignisse benannt werden. Bei den Gutachtern hatte die Klägerin eine Verschlechterung ihrer psychischen Befindlichkeit überwiegend auch mit den negativen Erfahrungen im Berufsleben begründet, das Mobbing, die Nichtverlängerung des Arbeitsvertrages, das Nichteinhalten von Arbeitszeiten und Arbeitstätigkeiten in ihrer Tätigkeit als Aushilfe und Kassiererin. Dr. W. hat in dem damit verbundenen beruflichen Scheitern des Ziels des Erreichens einer eigenständigen Erwerbstätigkeit und einer beruflichen Ausbildung auch einen entscheidenden Umstand für die Schwere der psychischen Belastung der Klägerin gesehen und hiermit das Ausmaß der quantitativen Leistungsminderung begründet.
Im Hinblick auf die Belastung der Klägerin durch den Selbstmordversuch ihres früheren Ehemannes weist Dr. G. darauf hin, dass die Schilderung der Klägerin völlig emotionslos, fast unbeteiligt erfolgte und keinerlei emotionale Reaktionen auslöste. Die Schilderung der Klägerin selbst widerspricht sich bei Dr. W. und bei Dr. G … Bei Dr. W. hatte sie angegeben, dass sie sich zum Tatzeitpunkt bei einer Bekannten aufgehalten und der Ehemann genau gewusst habe, dass sie in Kürze in die eheliche Wohnung zurückkomme. Er habe sich mit dem Bademantelgürtel aufgehängt und sie habe ihn aufgehängt gefunden, sie habe ihn herunterheben müssen und sie habe dann den Notarzt geholt, er habe noch geatmet. Sie habe intensive Angst verspürt, dass der Ehemann sich ein Messer hole und sie absteche, wenn er aufwache. Diese Furcht sei die größte gewesen, was passieren würde, wenn er eventuell aufwacht und sich rächen möchte. Gegenüber Dr. G. hat sie angegeben, dass sie bei einer Bekannten gewesen sei, aber ein komisches Gefühl gehabt habe, weshalb sie in ihre Wohnung zurückgekehrt sei. Ihr Mann habe im Abstellraum herumgenestelt. Sie habe dann nachsehen wollen, was er mache. Als sie ihr Exmann gesehen habe, habe er sich fallen lassen. Er habe den Bademantelgürtel um den Hals gehabt. Sie habe laut geschrien und ihn irgendwie hoch gehoben. Nach Entlassung aus der Psychiatrie, in der sich der Ehemann für 3 Tage befunden habe, habe er gesagt, dass sie in Zukunft auf ihn aufpassen müsse. Das habe sie aber auf keinen Fall gewollt. Schließlich sei er ausgezogen und habe sich eine Wohnung zwei Straßen weiter genommen. Sie habe sich dann so bald wie möglich scheiden lassen. Bei Dr. W. hat die Klägerin angegeben, dass der Exmann nach S-Stadt verzogen sei. In der stationären Behandlung im Klinikum A-Stadt 2015/2016 gelang es dann offenbar, herauszuarbeiten, dass die Klägerin deutlicher als bisher wahrnehmen konnte, dass sie auf ihren damaligen Mann bis heute eine große Wut empfinde und das Bedürfnis ihm mitzuteilen, was er ihr mit seinem inszenierten Suizidversuch angetan habe.
Auch die Einlassungen der Klägerin zu dem im Jahr 2005 erlittenen Verkehrsunfall sind inkonsistent. Sie gab an, in ein auf einer Kreuzung stehendes Auto gerast zu sein. Dieses Erlebnis sei so schlimm, dass sie sich nicht mehr Autofahren traue und allenfalls nur noch kurze Strecken zum Einkaufen fahre und auch das Haus kaum mehr verlasse. Andererseits ist sie aber wegen ihres neuen Ehemannes über mehrere Jahre gependelt, auch noch lange Zeit nach dem erlittenen Verkehrsunfall im Jahr 2005. Festgehalten ist eine Schulterprellung infolge des angelegten Sicherheitsgurtes durch den Unfall, aber keine weiteren Verletzungen. Auch aus den beigezogenen ärztlichen Befundberichten ergeben sich für den Senat keine Anhaltspunkte, dass die Einschätzung des Leistungsvermögens der Klägerin durch Dr. G. und Dr. N. unzutreffend sein könnten oder wesentliche Erkrankungen hätten übersehen worden sein können.
Der Hausarzt der Klägerin, Dr. C., hat in seinem Befundbericht vom 01.07.2016 von teils flüchtigen, teils fixen Gelenksschmerzen der Klägerin, vermehrt im LWS-Bereich, berichtet sowie von mentalen Beschwerden anamnestisch durch offenbar unsichere Situation einer Rentenbewilligung. An Diagnosen wurden von ihm mitgeteilt: – V. a. rheumatolog. Erkrankung am 07.08.2016 – Viraler Infekt der Atemwege am 16.11.2015 – Hordeolum rechts am 20.06.2016 – Lumbago rechts am 27.06.2016 Die Beschwerden seien wohl weitgehend gleich geblieben. Neue Leiden seien eine femoropatellare Arthrose links und Innenmeniskopathie links. Eine massive psychische Erkrankung berichtet er nicht. Der behandelnde Facharzt für Psychiatrie Dr. D. hat unter dem 04.07.2016 mitgeteilt, dass sich die Klägerin seit Juli 2015 lediglich einmal, nämlich am 19.02.2016, bei ihm vorgestellt habe, dass sie sich allerdings in der Zeit vom 24.11.2015 bis 05.01.2016 in stationärer Behandlung in der psychosomatischen Klinik des Klinikums A-Stadt befunden habe. An Diagnosen wurden mitgeteilt: – Posttraumatische Belastungsstörung – Rez. depressive Störung, mittelschwere Episode – Chronische Schmerzstörung – Panikstörung Die Klägerin habe am 19.02.2016 über vermehrte Schlafstörungen berichtet, daneben erhebliche Stimmungsschwankungen, Bedrohungsgefühle und Ängste. Der psychopathologische Befund vom 19.02.2016 sei geprägt gewesen von einer eher depressiv ausgelegten Stimmungslage bei eingeschränkter affektiver Schwingungsfähigkeit. Der Antrieb sei gedrückt erschienen, erkennbar sei eine deutliche psychomotorische Anspannung gewesen. Dr. F., Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, beschreibt in seinem Bericht vom 07.07.2016 an Diagnosen – Rez. depress. Störung, derzeit mittelgradig – Posttraumatische Belastungsstörung – Agoraphobie mit Panik – Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren – auf dem Hintergrund einer Entwicklungstraumatisierung bei Gewalterfahrungen im Elternhaus einer depressiven Grundstruktur und einer erneuten Traumatisierung im Erwachsenenalter durch den miterlebten Suizidversuch des Exmannes.
Seit November 2015 bestehe durchgehend Arbeitsunfähigkeit. Die Befunde hätten sich im Zeitraum der laufenden Therapie seit Ende 2014 nur geringfügig und nur in einigen Teilbereichen gebessert. So sei es der Klägerin zunehmend möglich, über sehr belastende Lebensereignisse zu sprechen. Dies gehe meist mit einer deutlichen Zunahme der körperlichen Beschwerden einher, aber mit einer Verbesserung der Selbstfürsorge. Eine Verbesserung der alltagsbezogenen Ängste und des damit verbundenen Vermeidungsverhaltens sei bisher nicht möglich gewesen. Die allgemeine Leistungsfähigkeit sei nach wie vor stark eingeschränkt. Der behandelnde Dr. E. berichtet unter dem 15.07.2016 über eine einmalige Vorstellung der Klägerin am 28.05.2015 wegen Beschwerden im linken Knie. Weitere orthopädische Erkrankungen werden nicht benannt. Diese Befundberichte bestätigen vielmehr, dass eine psychische Störung der Klägerin unzweifelhaft gegeben ist, die einer stützenden Behandlung durch ambulante psychotherapeutische Maßnahmen im Sinne einer Verhaltenstherapie und einer Änderung der Medikation bedarf. Diese Behandlungsnotwendigkeit allein begründet aber nicht die Annahme eines quantitativ geminderten Leistungsvermögens auf unter 6 Stunden täglich, nachdem eine deutliche Einschränkung der Erlebnis- und Gestaltungsfähigkeit der Klägerin nicht feststellbar ist.
Nach alledem war auf die Berufung der Beklagten hin der Gerichtsbescheid des SG Nürnberg vom 19.01.2016 aufzuheben und die Klage gegen den Bescheid vom 10.09.2014 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 17.10.2014 abzuweisen.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 193 SGG.
Gründe, die Revision gemäß § 160 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 SGG zuzulassen, liegen nicht vor.