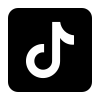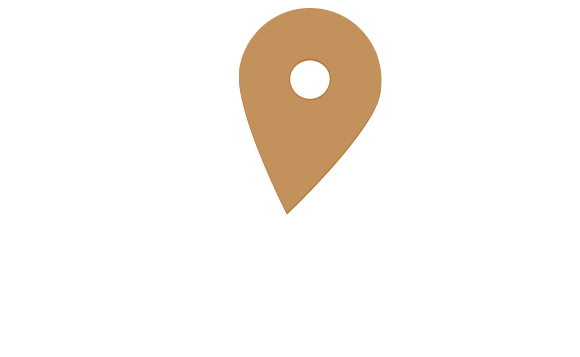Aktenzeichen AN 15 K 20.00528
BayVwVfG Art. 39 Abs. 2 Nr. 2
PAG Art. 54 Abs. 2, 62
Leitsatz
Tenor
1.Die Klage wird abgewiesen.
2.Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens.
Gründe
Die zulässige Klage ist unbegründet.
1. Die Klage ist insgesamt zulässig.
a) Insbesondere ist die Verpflichtungsklage als Versagungsgegenklage der statthafte Rechtsbehelf gegen die Entscheidung des Beklagten, die über den Kläger derzeit noch in den polizeilichen Datenbanksystemen gespeicherten personenbezogenen Daten nicht zu löschen, ggf. bestehende Löschungsfristen nicht zu verkürzen, sowie keinen Satzschutz zu gewähren (VG Ansbach, U.v. 10.12.2019 – 15 K 18.982 – BeckRS 2019, 34337; VG München, GB v. 7.7.2020 – M 7 K 19.1311 – BeckRS 2020, 26154 Rn. 16 f.). Der im Klageschriftsatz angekündigte reine Anfechtungsantrag hätte allein dem Kläger nicht zum begehrten Rechtsschutzziel verholfen. In der Umstellung von einem angekündigten Anfechtungszu einem in der mündlichen Verhandlung gestellten Verpflichtungsantrag ist jedoch keine Klageänderung im Sinne des § 91 VwGO zu erblicken. Eine Klageänderung liegt zwar vor bei Änderung des Klageantrags oder des Klagegrundes. Dabei ist hier eine Änderung des Klagegrundes, d. h. des dem Klagebegehren zugrundeliegenden historischen Vorgangs bzw. Sachverhalts, ersichtlich nicht erfolgt. Eine Änderung des Klageantrags ist im Ergebnis aber ebenfalls nicht gegeben. Die vorliegende Umstellung einer Anfechtungsklage auf eine Verpflichtungsklage fällt vielmehr unter die – über § 173 Satz 1 VwGO auch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren anwendbare – Ausnahmevorschrift des § 264 Nr. 2 ZPO. Hiernach gelten u.a. Erweiterungen des Klageantrags nicht als Klageänderung (OVG Münster, U.v. 4.7.2012 – 1 A 1339/10 – BeckRS 2012, 53979). § 264 Nr. 2 ZPO erfasst auch qualitative Veränderungen des Klagebegehrens. Voraussetzung ist, dass das neue Begehren im Vergleich zum bisherigen nicht als aliud einzustufen ist. Eine Erweiterung im Sinne von § 264 Nr. 2 ZPO liegt danach vor, wenn das bisherige Begehren als inhaltsgleiches Minus des neuen Begehrens angesehen werden kann (Bacher, in: BeckOK ZPO, 40. Ed. Stand: 1.3.2021, ZPO § 264 Rn. 5). Eine solche Erweiterung des Begehrens hat hier stattgefunden. Denn die Frage, ob der Beklagte durch seine ablehnende Entscheidung den Anspruch des Klägers auf informationelle Selbstbestimmung sowie als Ausfluss dessen auf Berichtigung oder Löschung von über ihn gespeicherten Daten verletzt hat, ist zugleich wesentlicher Bestandteil der Prüfung, ob der Kläger – wegen der genannten Rechtsverletzung – eine Berichtigung oder Löschung verlangen kann.
Jedenfalls aber liegen die Voraussetzungen des § 91 Abs. 1 VwGO hier auch vor, denn der Beklagtenvertreter hat der Klageänderung in der mündlichen Verhandlung nicht widersprochen, ihr vielmehr zumindest konkludent zugestimmt. Auf die Frage, ob die Klageänderung daher ggf. sachdienlich ist, kommt es nicht entscheidend an. Ebenso wenig bedarf es näherer Erörterung, ob das Verpflichtungsbegehren auch bereits bei sachdienlicher Auslegung der Schriftsätze des (anwaltlichen) Klägerbevollmächtigten nach § 88 VwGO anzunehmen gewesen wäre (vgl. dazu VG München, GB v. 7.7.2020, a.a.O. sowie allgemein BayVGH, B.v. 10.12.2018 – 11 CS 18.2480 – BeckRS 2018, 32452).
b) Es fehlt dem Kläger auch nicht am Rechtschutzbedürfnis für seine vorliegende Klage vor dem Hintergrund der Bestandskraft des Bescheids des Beklagten vom 8. September 2016 aufgrund der Klagerücknahme des Klägers mit Schreiben vom 19. Juli 2019 im Verfahren AN 15 K 19.01297 insoweit, als jener Bescheid bereits eine deckungsgleiche Regelung zum Löschungsanspruch des Klägers gegenüber dem Inhalt des hier streitgegenständlichen Schreibens trifft. Bei dem streitgegenständlichen Schreiben des Beklagten an den Kläger vom 20. Februar 2020 handelt es sich gegenüber dem Bescheid vom 8. September 2016 nicht um eine lediglich wiederholende Verfügung mit der Folge, dass sich das streitgegenständliche Schreiben selbst nicht als Verwaltungsakt im Sinne des Art. 35 Satz 1 BayVwVfG darstellen würde, soweit es mit dem Regelungsgegenstand des Bescheids vom 8. September 2016 deckungsgleich ist. Es liegt ein Zweitbescheid vor. Zu dieser Erkenntnis ist das Gericht durch Auslegung des streitgegenständlichen Schreibens anhand des objektiven Erklärungswerts unter Berücksichtigung der Begleitumstände (§ 133 BGB in entsprechender Anwendung – vgl. BVerwG, B.v. 29.1.2016 – 8 B 6/16 – BeckRS 2016, 43479 Rn. 9) gelangt.
aa) Die Rechtsprechung differenziert zwischen wiederholender Verfügung und Zweitbescheid danach wie folgt:
„Wenn eine behördliche Erklärung sich in der bloßen ganz oder teilweisen Wiederholung eines bereits ergangenen Verwaltungsakts ohne neuen Regelungsgehalt oder in einem Hinweis auf einen solchen erschöpft (sog. „wiederholende Verfügung”, vgl. etwa: BVerwG, U.v. 10.10.1961 – VI C 123/59 – NJW 1962, 362), so liegt kein Verwaltungsakt vor (BSG, U.v. 24.6.2020 – B 4 AS 7/20 R – BeckRS 2020, 18946 Rn. 16; BFH, B.v. 20.7.2012 – VI B 21/12 – BeckRS 2012, 95947; OVG Saarlouis, B.v. 26.4.2016 – 1 A 103/15 – BeckRS 2016, 45364; BayVGH, B.v. 24.10.2017 – 3 ZB 17.906 – BeckRS 2017, 131743 Rn. 10; VG Köln, B.v. 4.6.2012 – 23 L 228/12 – BeckRS 2012, 55905; VG Regensburg, U.v. 26.1.2017 – 7 K 16.1541 – BeckRS 2017, 111562 Rn. 15). Demgegenüber wird ein auf erneuter Sachprüfung und -entscheidung beruhender „Zweitbescheid” stets als Verwaltungsakt angesehen (vgl. BVerwG, B.v. 10.8.1995 – 7 B 296.95 – BeckRS 1995, 31232376; VG Neustadt a. d. Weinstraße, U.v. 6.4.2006 – 4 K 1919/05 – BeckRS 2006, 23207). Ob ein Bescheid (ganz oder teilweise) als Zweitbescheid oder lediglich als wiederholende Verfügung anzusehen ist, bestimmt sich danach, ob und inwieweit die Behörde durch ihre Verlautbarung eine neue Sachentscheidung getroffen hat. Das ist durch Auslegung der Verfügung zu ermitteln (vgl. BVerwG, B.v. 25.2.2016 – 1 WB 33.15 – juris Rn. 35). Hierfür kommt es auf deren Erklärungsinhalt an, der durch fallbezogene, die konkreten Umstände in den Blick nehmende Auslegung nach Maßgabe der entsprechend anwendbaren gesetzlichen Auslegungsregeln der §§ 133, 157 BGB zu ermitteln ist (vgl. BVerwG, B.v. 14.6.2010 – 2 B 23.10 – juris Rn. 7). Für die Abgrenzung des anfechtbaren Verwaltungsaktes/Zweitbescheides von der „wiederholenden Verfügung“ ist die Behördenäußerung nicht ohne Rücksicht auf ihr Erscheinungsbild zu würdigen. Maßgebend ist nicht der innere, sondern der erklärte Wille. Dieser Grundsatz verlangt Eindeutigkeit der Erklärung. Eine nachträgliche Erläuterung kann die eingetretene, das Wesen der Behördenäußerung selbst betreffende Wirkung nicht mehr beseitigen (vgl. BVerwG, U.v. 25.10.1965 – VI C 51.63 – juris). In der Regel ist von einer erneuten Sachentscheidung dann ausgegangen werden, wenn sich die tragenden Erwägungen der Begründung in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht gegenüber der ursprünglichen Entscheidung erheblich geändert haben (OVG Magdeburg, B.v. 23.4.2018 – 3 L 85/16 – BeckRS 2018, 42228 Rn. 29).“
bb) Dies zugrunde gelegt gelangt das Gericht in Übereinstimmung mit der Rechtsmeinung des Klägervertreters zu der Überzeugung, dass das Bayerische Landeskriminalamt im Fall des Klägers mit seinem Schreiben vom 20. Februar 2020 einen Zweitbescheid und nicht lediglich eine wiederholende Verfügung zum Bescheid vom 8. September 2016 erlassen hat. Bereits das äußere Erscheinungsbild des Schreibens, das insgesamt inhaltlich – wenn auch z.T. knapp – auf alle zuvor vom Kläger gestellten Anträge auf Löschung, Datenkorrektur und Satzschutz eingeht, sowie die Angabe einer Rechtbehelfsbelehrung am Ende des Schreibens sprechen für einen erneuten Bescheid. Zwar kommt nach der vorzitierten obergerichtlichen Rechtsprechung ein neuer bzw. Zweitbescheid auch nur für einzelne, teilbare Regelungsgegenstände in Betracht, so dass insoweit zutreffend eine Rechtsbehelfsbelehrung:mitzugeben war. Der Antrag des Klägers auf Setzen eines Satzschutzes ist ein solcher neuer Regelungsgegenstand, der im Rechtssinne teilbar ist und bislang von ihm auch noch nicht gefordert war. Dem gegenüber stellt sich der Antrag des Klägers auf Löschung von Datensätzen aus den KAN/IGVP-Datenbanken nicht als neu im Vergleich zur bestandskräftigen Regelung im Bescheid vom 8. September 2016 dar, so dass die Annahme eines Zweitbescheides für diesen Regelungsgegenstand nicht zwingend ist. Dennoch erkennt das Gericht, abstellend auf den objektiven Erklärungswert des Schreibens vom 20. Februar 2020, auch dahingehend eine erneute Überprüfung des Löschungsbegehrens des Klägers durch das Landeskriminalamt. Zutreffend hat der Klägervertreter darauf hingewiesen, dass es dem Schreiben vom 20. Februar 2020 an einer eindeutigen, unmissverständlichen Inbezugnahme auf den bestandskräftigen Bescheid vom 8. September 2016 fehlt. Stattdessen wählte der Beklagte in seinem Schreiben vom 20. Februar 2020 zu den einzelnen Punkten unter „Zum Antrag 7.1“ (vgl. S. 2 ff. des Schreibens) Formulierungen wie: „Ein Anspruch auf Löschung ist daher weiterhin nicht zu erkennen.“ (Anm.: Hervorhebung nicht im Original, sondern durch das Gericht), was für den objektiven Betrachter in der Rolle des Klägers nahelegt, dass das Landeskriminalamt sich trotz des kurz zuvor bestandskräftig abgeschlossenen ersten Verwaltungsverfahrens noch einmal in der Sache mit dem Löschungsbegehren des Klägers befasst hat und dazu auch eine neue Regelung als Verwaltungsakt treffen wollte.
Im Ergebnis liegt daher ein neuer Verwaltungsakt inhaltlicher Art vor, d.h. der Beklagte hat es nicht lediglich abgelehnt, das vorangegangene Verwaltungsverfahren hinsichtlich der Löschung von Datensätzen zum Kläger mangels neuer Sach- oder Rechtslage wiederaufzugreifen. Vielmehr hat der Beklagte inhaltlich eine neue Regelung zum Löschungsbegehren getroffen, ungeachtet des Umstandes, dass diese Regelung so ausfiel, wie bereits auch im Bescheid vom 8. September 2016 getroffen.
2. Die Klage ist im maßgeblichen Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung (vgl. VG Würzburg, U.v. 29.10.2015 – W 5 K 14.1307 – BeckRS 2016, 42857) unbegründet.
a) Der Bescheid des LKA vom 20. Februar 2020 ist nicht schon wegen formeller Fehler im Verwaltungsverfahren aufzuheben. Der vom Kläger gerügte Mangel in der Begründung des streitgegenständlichen Bescheids liegt nicht vor.
aa) Gemäß Art. 39 Abs. 1 BayVwVfG ist ein schriftlicher oder elektronischer sowie ein schriftlich oder elektronisch bestätigter Verwaltungsakt mit einer Begründung zu versehen. In der Begründung sind die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe mitzuteilen, die die Behörde zu ihrer Entscheidung bewogen haben. Die Begründung von Ermessensentscheidungen soll auch die Gesichtspunkte erkennen lassen, von denen die Behörde bei der Ausübung ihres Ermessens ausgegangen ist. Wesentlich sind die Gründe dann, wenn sie mit den Gründen tatsächlich übereinstimmen, die die Behörde der Entscheidung zugrunde gelegt hat (tragende Gründe). Welche Anforderungen an Inhalt und Umfang einer Begründung zu stellen sind, lässt sich nicht allgemein beantworten. Das hängt von den Besonderheiten des Rechtsgebiets, von der Komplexität des Sachverhalts und von der Zahl der zu klärenden Einzelprobleme ebenso ab wie davon, welche Rechte betroffen sein können, welche Aspekte im Verwaltungsverfahren überhaupt kontrovers waren (OVG Münster, B.v. 16.12.1977 – IV B 2122/77 – NJW 1978, 1764; VGH Kassel, B.v. 28.6.2006 – 7 UZ 2930/05 – NVwZ-RR 2006, 776) und von welchem allgemeinen Kenntnisstand der Beteiligten ausgegangen werden kann (BVerwG, U.v. 9.5.1985 – 2 C 16/83 – NVwZ 1986, 375; VG München, U.v. 16.12.1999 – M 29 K 99.1991 – NVwZ-RR 2000, 742) sowie auch davon, ob es sich um eine Regel- oder um eine Ausnahmeentscheidung handelt (Tiedemann, in: BeckOK VwVfG, 53. Ed. 1.10.2021, VwVfG § 39 Rn. 26). Die Begründung muss sich auf den konkreten Einzelfall beziehen und darf sich nicht in formelhaften allgemeinen Darlegungen erschöpfen. Eine lediglich formelhafte oder sehr allgemein gehaltene Begründung versetzt den Betroffenen nicht in die Lage, sich über einen eventuellen Rechtsbehelf schlüssig zu werden und ihn gegebenenfalls sachgerecht zu begründen (Tiedemann, in: BeckOK VwVfG, 53. Ed. 1.10.2021, VwVfG § 39 Rn. 30). In rechtlicher Hinsicht muss die Begründung die Normen nennen, auf denen sie beruht (VGH Kassel, U.v. 13.6.2007 – 5 UE 1179/06 – NVwZ-RR 2008, 221). Die Heranziehung unzutreffender Rechtsvorschriften kann die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsakts begründen, stellt aber keinen Fehler hinsichtlich der Begründungspflicht dar. Auch falsche rechtliche Begründungen geben Auskunft darüber, auf welche Gründe die Behörde den Verwaltungsakt gestützt hat. Nichts Anderes fordert die Begründungspflicht (Tiedemann, in: BeckOK VwVfG, 53. Ed. 1.10.2021, VwVfG § 39 Rn. 37 mit Rechtsprechungsnachweisen).
Nach Art. 39 Abs. 2 BayVwVfG bedarf es einer Begründung nicht, 1. soweit die Behörde einem Antrag entspricht oder einer Erklärung folgt und der Verwaltungsakt nicht in Rechte eines anderen eingreift, 2. soweit demjenigen, für den der Verwaltungsakt bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird, die Auffassung der Behörde über die Sach- und Rechtslage bereits bekannt oder auch ohne Begründung für ihn ohne weiteres erkennbar ist, 3. wenn die Behörde gleichartige Verwaltungsakte in größerer Zahl oder Verwaltungsakte mit Hilfe automatischer Einrichtungen erlässt und die Begründung nach den Umständen des Einzelfalls nicht geboten ist, 4. wenn sich dies aus einer Rechtsvorschrift ergibt, 5. wenn eine Allgemeinverfügung öffentlich bekanntgegeben wird. Diese Vorschrift statuiert die Befugnis der Behörde, in bestimmten Fällen ausnahmsweise von einer Begründung ganz oder teilweise abzusehen. Die Regelung dient allein der Vereinfachung des Verwaltungshandelns und damit praktischen Bedürfnissen, deren Beachtung dort ihre Grenzen finden muss, wo verfassungsrechtliche Prinzipien eingreifen. Der Verzicht auf eine Begründung muss deshalb, auch wenn er vom Wortlaut des Absatzes 2 gedeckt ist, stets darauf überprüft werden, ob er mit den verfassungsrechtlich begründeten Funktionen der Begründungspflicht vereinbar ist. Die Entscheidung, von der Befugnis des Absatzes 2 Gebrauch zu machen, liegt im Ermessen der Behörde. Da das Absehen von einer Begründung selbst kein Verwaltungsakt ist, bedarf diese Entscheidung nicht selbst der Begründung (VGH Mannheim, B.v. 24.2.1983 – A 12 S 1043/82 – NVwZ 1983, 629; Tiedemann, in: BeckOK VwVfG, 53. Ed. 1.10.2021, VwVfG § 39 Rn. 57, 58).
bb) Dies als Maßstab zugrunde gelegt ist zwar einerseits festzustellen, dass der streitgegenständliche Bescheid keine gesetzlichen Normen nennt, anhand derer die Anträge des Klägers auf Löschung von Daten, Berichtigung von Daten und Einrichtung einer Satzsperre rechtlich beurteilt wurden. Ausführungen mit einem konkreten Normbezug werden in diesem Bescheid nur insoweit angestellt, als der Kläger darüber informiert wird, wie die einzelnen strafrechtlichen Ermittlungsverfahren seitens der Staatsanwaltschaft behandelt wurden, nämlich überwiegend mit einer Einstellung nach § 170 Abs. 2 StPO und in Teilen mit einer Einstellung nach § 153 Abs. 1 StPO.
Gleichwohl weist der streitgegenständliche Bescheid insoweit kein Begründungsdefizit auf, da der Beklagte vorliegend ausnahmsweise von einer weitergehenden Begründung aufgrund von Art. 39 Abs. 2 Nr. 2 BayVwVfG absehen durfte. Dem Kläger war aufgrund des vorangegangenen, auch im Wege einer gerichtlichen Beurteilung unterzogenen Verwaltungsverfahrens, in welchem er einen gleichartigen Löschungsanspruch gegen den Beklagten geltend machte, hinreichend bekannt, auf welchen rechtlichen Grundlagen und Erwägungen der Beklagte das Begehren des Klägers überwiegend ablehnte. Der Kläger ist überdies ein erfahrener Polizeibeamter im Dienstgrad eines Hauptkommissars, dem die rechtlichen Grundlagen des polizeilichen Datenschutzrechts und insbesondere auch die Möglichkeiten und die Bedeutung eines Satzschutzes in den polizeilichen Datenbanken ohne Weiteres bekannt sind. Das ergibt sich auch aus dem Umstand, dass der Kläger in seinen vorprozessualen Schreiben an das LKA die entsprechenden Normen des Polizeiaufgabengesetzes, die für die Beurteilung der Sach- und Rechtslage relevant sind, selbst nennt. Nach Überzeugung des Gerichts hat der Kläger mit seinem neuerlichen Löschungs- und Berichtigungsbegehren auch keine substantiell neuen Aspekte vorgetragen, die einer vertieften und ergänzenden Auseinandersetzung mit seinen Argumenten seitens des Beklagten in Gegenüberstellung des vorangegangenen, bestandskräftig gewordenen Bescheids vom 8. September 2016 bedurften. Dies ergibt sich daraus, dass der Kläger in dem gerichtlichen Verfahren betreffend die Überprüfung des Bescheids vom 8. September 2016 bis in das Jahr 2018 hinein – nämlich innerhalb des Beschwerdeverfahrens vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof im Hinblick auf die versagte Prozesskostenhilfe – noch einmal umfangreich ergänzend zu seinem Standpunkt vorgetragen hat, damit jedoch in der Sache nicht zu überzeugen vermochte und er diesen ergänzenden Vortrag – in Gegenüberstellung seiner diesbezüglichen Schriftsätze im Beschwerdeverfahren einerseits und im zweiten behördlichen Verwaltungsverfahren andererseits – im zweiten Verwaltungsverfahren, das zum hier streitgegenständlichen Bescheid führte, lediglich wiederholte. Es gab und gibt keine neuen sachlichen oder rechtlichen Argumente, mit denen sich entweder seitens des Beklagten oder der Verwaltungsgerichte nicht schon auseinandergesetzt worden wäre. Soweit der Beklagte dem erneuten Löschungsbegehren des Klägers gleichwohl in drei Fällen nachgekommen ist, handelte er insoweit nicht aufgrund einer Neubewertung des Sachverhaltes, sondern holte damit lediglich eine bereits im Jahr 2017 angeordnete Löschungsumsetzung nach (vgl. Bl. 434R d. Behördenakte) und informierte den Kläger hierüber.
In Anbetracht der konkreten Umstände des Einzelfalles, insbesondere des Umfangs des ersten Verwaltungs- und Verwaltungsstreitverfahrens und der Kenntnisse des Klägers sowohl aufgrund seiner beruflichen Stellung als auch vor dem Hintergrund der vom Kläger in dem ersten Verwaltungsstreitverfahren an den Tag gelegten Eigeninitiative seines Vortrags und schließlich auch vor dem Hintergrund der nur geringen zeitlichen Dauer zwischen der vom Kläger im ersten Verwaltungsstreitverfahren erklärten Klagerücknahme und der danach erfolgten erneuten Initiierung eines behördlichen Verwaltungsverfahrens verstieß der Beklagte im nunmehr zu beurteilenden Bescheid vom 20. Februar 2020 auch nicht vor der dem Hintergrund der verfassungsrechtlichen Intention des Begründungserfordernisses gegen diese Pflicht. Dem Kläger erwächst aus dem Begründungserfordernis des Art. 39 Abs. 1 BayVwVfG zwar ein Anspruch auf sachgerechte Inkenntnissetzung der tragenden Gründe zur effektiven Wahrung von Rechtsschutzmöglichkeiten, nicht jedoch darauf, dass immer gleicher und dem Grunde nach bereits verbeschiedener Sachvortrag ihm erneut in aller Breite dargelegt wird. Denn dem Kläger sind die tragenden Erwägungen bereits bekannt und kann er sein Rechtschutzverhalten demnach auch sachgerecht darauf ausrichten. Art. 39 Abs. 1 BayVwVfG verpflichtet dem gegenüber nicht als Norm zu einer reinen Förmelei, was sich gerade aus Absatz 2 Nr. 2 des Art. 39 BayVwVfG ergibt, so dass nicht schon dann ein Aufhebungsanspruch bezüglich des streitgegenständlichen Bescheids besteht, wenn dieser keinerlei rechtlichen Normen nennt.
b) Der Bescheid ist auch materiell nicht zu beanstanden.
aa) Die Speicherung von personenbezogenen Daten im KAN, welche die Polizei im Rahmen eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens oder von Personen gewonnen hat, die verdächtig sind, eine Straftat begangen zu haben, richtet sich nach Art. 54 Abs. 2 Satz 1 PAG i.V.m. § 484 Abs. 1 Satz 1, Abs. 4 StPO. Nach Art. 54 Abs. 1 PAG kann die Polizei zudem – beispielsweise im IGVP – solche Daten in Akten oder Dateien speichern, verändern und nutzen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben zu einer zeitlich befristeten Dokumentation oder zur Vorgangsverwaltung erforderlich ist (Art. 2 Abs. 1, 30 PAG).
Ein Anspruch auf unverzügliche Löschung der im KAN gespeicherten personenbezogenen Daten besteht, wenn der der Speicherung zugrundeliegende Verdacht gegen den Betroffenen entfallen ist (Art. 54 Abs. 2 Satz 2 PAG; zuvor schon Art. 38 Abs. 2 Satz 2 PAG a.F.). Daneben besteht – insbesondere für allgemeine Eintragungen im IGVP – ein alle Daten in polizeilichen Sammlungen betreffender allgemeiner Löschungsanspruch aus Art. 62 Abs. 2 Satz 1 PAG (zuvor schon Art. 45 Abs. 2 PAG a.F.), wenn ihre Erhebung oder weitere Verarbeitung unzulässig war (Art. 62 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 PAG), sie zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung gelöscht werden müssen (Nr. 2) oder bei der zu bestimmten Fristen oder Terminen vorzunehmenden Überprüfung oder aus Anlass einer Einzelfallbearbeitung festgestellt wird, dass ihre Kenntnis für die speichernde Stelle zur Erfüllung der ihr obliegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich ist (Nr. 3).
Der Tatverdacht im Sinne des Art. 54 Abs. 2 Satz 2 PAG ist entfallen, wenn kein Straftatbestand erfüllt ist, der Betroffene nicht als Täter in Betracht kommt oder ihm ein Rechtfertigungsgrund zur Seite steht. Dagegen reicht zur weiteren Speicherung ein weiterhin bestehender Anfangsverdacht im strafprozessualen Sinne aus, es muss sich nicht um einen hinreichenden Tatverdacht i.S.d. § 203 StPO handeln. Eine Einstellung nach §§ 153 ff. StPO lässt den Tatverdacht nicht entfallen. Bei Einstellungen nach § 170 Abs. 2 StPO ist jeweils zu prüfen, ob die Einstellung wegen erwiesener Unschuld erfolgt ist oder ob ein „Restverdacht“ fortbesteht, wenn etwa ein Tatnachweis vor Gericht nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit geführt werden kann (stRspr des 10. Senats des BayVGH, vgl. etwa BayVGH, B.v. 10.6.2013 – 10 C 13.62 – juris Rn. 5; B.v. 30.1.2020 – 10 C 20.10 – juris Rn. 8; B.v. 2.11.2020 – 10 C 20.2308 – BeckRS 2020, 30383 Rn. 7, 8).
Die nach Art. 53 Abs. 5 PAG festzulegenden Prüfungstermine oder Aufbewahrungsfristen betragen nach Art. 54 Abs. 2 Satz 3 PAG in der Regel bei Erwachsenen zehn Jahre, bei Jugendlichen fünf Jahre und bei Kindern zwei Jahre. Art. 54 Abs. 2 Satz 3 PAG definiert diese Fristen als Regelfristen (nach BayVerfGH, E.v. 19.10.1994 – Vf. 12-VII/92 u.a. – NVwZ 1996, 166 (168) handelt es sich um Regelhöchstfristen). In Art. 54 Abs. 2 Satz 4 PAG sieht der Gesetzgeber die Möglichkeit kürzerer und in Absatz 3 die Möglichkeit längerer Fristen vor. Die Festlegung kürzerer Fristen aufgrund geringer Bedeutung des Falles kommt insbesondere bei Fahrlässigkeitstaten in Betracht. Nach Art. 54 Abs. 2 Satz 5 PAG beginnt die Frist regelmäßig mit dem Ende des Jahres, in dem das letzte Ereignis erfasst worden ist, das zur Speicherung der Daten geführt hat, jedoch nicht vor Entlassung des Betroffenen aus einer Justizvollzugsanstalt oder der Beendigung einer mit Freiheitsentziehung verbundenen Maßregel der Besserung und Sicherung. Nach Art. 54 Abs. 2 Satz 6 PAG erfolgt keine Löschung aufbewahrter Daten, wenn während der Aufbewahrung neue aufbewahrungsfähige Daten erlangt werden. Es gilt dann für alle aufbewahrungsfähigen Daten die längste der einzelnen Aufbewahrungsfristen. Das kann diejenige des letzten Datums, aber – falls diese länger ist – auch diejenige eines früheren sein (Aulehner, in: BeckOK PolR Bayern, 15. Ed. Stand: 1.11.2020, PAG Art. 54 Rn. 46).
Unerheblich für die Anwendung des Art. 54 Abs. 2 und 3 PAG ist schließlich, dass ein Vorgang im IGVP-System anstatt bzw. nicht auch oder korrespondierend zusätzlich im KAN-System gespeichert ist, sofern der Erfassung des jeweiligen Vorgangs ein Straftatverdacht des Betroffenen zugrunde gelegen hat. Entscheidend kommt es nämlich auf die Zielrichtung der Speicherung durch die Polizei an (BayVGH, U.v. 21.1.2009 – 10 B 07.1382 – BeckRS 2009, 42891; VG München, U.v. 10.12.2014 – 7 K 12.1563 – BeckRS 2014, 122254). Ansonsten beträgt die Speicher- bzw. Löschungsfrist für reine Vorgangsdaten im IGVP-System regelmäßig fünf Jahre (BayVGH, B.v. 24.2.2015 – 10 C 14.1180 – BeckRS 2015, 43079 Rn. 24).
bb) Dies als Maßstab zugrunde gelegt erweist sich die Klage mit dem Antrag auf Verpflichtung des Beklagten zum Löschen von Datensätzen im KAN und im IGVP als unbegründet. Ein solcher Anspruch steht dem Kläger nicht zu (§ 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO).
(1) Der Resttatverdacht ist für die im KAN und dazu korrespondierend im IGVP gespeicherten Datensätze zu strafrechtlichen Ermittlungsverfahren, die gegen den Kläger geführt wurden, nicht entfallen, soweit die Ermittlungsverfahren nach § 153 StPO eingestellt wurden (Datensätze vom 18.2.2013 zum Verdacht der Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Schriften und Datensatz vom 24.6.2014 zur Verletzung von Dienstgeheimnissen). Das erkennende Gericht geht davon aus, dass eine eigenständige Prüfung der Polizei zum Resttatverdacht bei Verfahrenseinstellungen aus Opportunitätsgründen im Regelfall nicht erforderlich ist, da dies nur in den Fällen notwendig ist, in denen bei einer endgültigen Verfahrenseinstellung, der Ablehnung der Eröffnung des Hauptverfahrens oder einem rechtskräftigen Freispruch keine Feststellungen der Staatsanwaltschaft oder des Gerichts zum (Rest-)Verdacht getroffen wurden (BayVGH, B.v. 10.6.2013 – 10 C 13.62 – juris Rn. 4 f. und BayVGH, B.v. 1.8.2012 – 10 ZB 11.2438 – juris Rn.3.). Bei Verfahrenseinstellungen nach §§ 153 ff. StPO wird aber teilweise eine Feststellung zum Tatverdacht getroffen oder es besteht der durch die Anklagerhebung bzw. die Eröffnung des Hauptverfahrens von der Staatsanwaltschaft bzw. vom Gericht bejahte Tatverdacht trotz der Einstellungsverfügung fort (BayVGH, B.v. 1.8.2012 – 10 ZB 11.2438 – juris Rn. 3). Dies ergibt sich schon daraus, dass bei einem Absehen von der Erhebung der öffentlichen Klage bzw. der Verfolgung einer Straftat nach diesen Bestimmungen der fortbestehende Tatverdacht letztlich vorausgesetzt wird (BayVGH, B.v.10.6. 2013 – 10 C 13.62 – juris Rn. 5). Ansonsten hätte eine Einstellung nach § 170 Abs. 2 StPO zu erfolgen (vgl. auch: VG Ansbach, U.v. 24.8.2021 – AN 15 K 18.1958 – BeckRS 2021, 25541 Rn. 36). Insoweit kommt es auf die vom Kläger aufgeworfene Problematik, dass die Einstellungen aus seiner Sicht vorschnell erfolgt seien und er vor allem das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Besitzes/Erwerbs/Verbreitung kinderpornographischer Schriften als komplex erachte, weshalb dazu auch die durchgeführten Ermittlungsmaßnahmen näher zu beleuchten und zu bewerten seien (vgl. dazu vor allem den Schriftsatz des Klägers an das Bayerische Landeskriminalamt vom 31. Januar 2020 – Bl. 426 ff. d. Behördenakte) für den vorliegenden Streitgegenstand nicht an. Das Verwaltungsgericht ist nicht „Ersatz-Staatsanwaltschaft“ und prüft insbesondere im Rahmen einer Löschungsklage der vorliegenden Art nicht, ob richtigerweise eine Einstellung des Verfahrens nach § 170 Abs. 2 StPO wegen erwiesener Unschuld anstatt nach § 153 Abs. 1 StPO hätte erfolgen müssen (BayVGH, B.v. 1.8.2012 – 10 ZB 11.2438 – BeckRS 2012, 56389 Rn. 3). Der Kläger verkennt, dass für die fortgesetzte Speicherung der diesbezüglichen Verfahrensdaten im KAN und im IGVP letztlich nur einen Resttatverdacht vorausgesetzt wird, nicht jedoch auch einen hinreichenden Tatverdacht, der die Staatsanwaltschaft zur Anklageerhebung ermächtigt. Ein solcher Resttatverdacht besteht insbesondere bei dem Ermittlungsverfahren wegen Besitzes/Erwerbs/Verbreitung kinderpornographischer Schriften gerade auch vor dem Hintergrund, dass sich die Klärung der Einzelfallumstände als komplex erwies und jedenfalls nach Überzeugung der für die Strafverfolgung zuständigen Staatsanwaltschaft den Kläger nicht restlos zu entlasten vermochte. Allein hierauf kommt es für die Rechtmäßigkeit der Speicherung der Ermittlungsdaten im KAN und korrespondierend dazu auch im IGVP nach gefahrenabwehrrechtlichen Gesichtspunkten des PAG an, soweit ein Resttatverdacht zu begründen ist.
(2) Daneben sind auch die Entscheidungen des Beklagten, dem Löschungsbegehren des Klägers bezüglich derjenigen Datensätze zu strafrechtlichen Ermittlungsverfahren, die nach § 170 Abs. 2 StPO eingestellt wurden, nicht zu entsprechen, nicht zu beanstanden. Auch insoweit liegt zunächst ein Resttatverdacht vor, denn in allen Fällen ist es nicht zu Einstellungen wegen erwiesener Unschuld gekommen, sondern lagen Konstellationen vor, bei denen ein Tatverdacht gegen den Kläger letztlich nicht ausgeräumt werden konnte. Zur Vermeidung von Wiederholungen nimmt das Gericht auf den Beschluss der Kammer vom 7. August 2017 im Prozesskostenhilfeverfahren zum Verfahren AN 15 K 16.01976 sowie auf den Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 17. Juni 2019 im Verfahren 10 C 17.1793 (beide in Gerichtsakte AN 15 K 19.01297) Bezug und macht sich die dort wiedergegebenen Gründe zu eigen und legt sie auch den Entscheidungsgründen im vorliegenden Urteil zugrunde (§ 117 Abs. 5 VwGO entsprechend). Soweit der Kläger im Beschwerdeverfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof und auch in seinem Schriftsatz an das Bayerische Landeskriminalamt vom 31. Januar 2020 erwidernd und umfangreich vorträgt, handelt es sich in der Sache nicht um neuen, beachtlichen Vortrag, der die Einschätzungen des Beklagten zum fortbestehenden Resttatverdacht erschüttert. Vielmehr beansprucht der Kläger mit diesem Vortrag nur die Deutungshoheit über seine Ansicht, warum die Einstellungen wegen erwiesener Unschuld zu erfolgen gehabt hätten. Er verkennt hierbei, dass der Beklagte im Bereich der Datenspeicherung nach Art. 54 PAG jedoch keine umfangreichen Aufklärungsbemühungen zu den Straftatverdachtsmomenten schuldet, sondern lediglich eine Prüfung von zureichenden Anhaltspunkten für einen Resttatverdacht. Solche Anhaltspunkte liegen schon dann vor, wenn eine Aussage-gegen-Aussage-Konstellation dem Ermittlungsverfahren zugrunde lag, die die Staatsanwaltschaft letztlich dazu bewog, das Verfahren zu Gunsten des Klägers nach § 170 Abs. 2 StPO einzustellen. Eine solche Konstellation liegt beispielsweise in dem Sachverhalt zum Datensatz vom 13.12.2010 wegen des Verdachts der Urkundenfälschung durch Verwenden einer eingescannten Unterschrift der damaligen Ehefrau des Klägers an den Hausarzt vor.
Ergänzend ist auszuführen, dass auch bezüglich des Datensatzes vom 16.7.2014 betreffend den Vorwurf des Verstoßes gegen das Urheberrechtsgesetz ein Resttatverdacht besteht. Soweit der Kläger meint, ein Straftatverdacht liege aufgrund der von ihm angefertigten Sicherungskopien des Programms „MS-Office 2000“ per se fern, verkennt er, dass der Verdacht wegen Verstoßes gegen die strafrechtliche Norm des § 106 Abs. 1 UrhG nur dann restlos entfällt, wenn die Voraussetzungen zum Anfertigen einer Sicherungskopie nach § 69d Abs. 2 Satz 1 UrhG gegeben waren. Insbesondere setzt dies voraus, dass die Anfertigung der Kopien deshalb erfolgte, weil dies „für die Sicherung künftiger Benutzung erforderlich“ war. Die Erforderlichkeit ist dann nicht mehr gegeben, wenn dem Softwarenutzer eine Sicherungskopie zur Verfügung gestellt wird (vgl. Wandtke/Bullinger/Grützmacher, 5. Aufl. 2019, UrhG § 69d Rn. 67 m.w.N.). Im vorliegenden Fall stehen die Voraussetzungen des § 69d Abs. 2 Satz 1 UrhG schon deshalb nicht sicher fest, weil der Kläger weder das Originalprogramm vorlegen konnte, noch einen Kaufbeleg darüber und zudem die Lizenzvertragsdetails im Einzelnen nicht bekannt sind. Dass es vorliegend an einem Strafantrag des Lizenzgebers bzw. Urheberrechtsinhabers fehlte, ist für die Frage der Annahme eines Resttatverdachts im Sinne des Art. 54 PAG unerheblich, denn dies betrifft nur die Frage der Verfolgbarkeit der möglichen Straftat.
(3) Bei einem wie hier fortbestehenden Resttatverdacht steht auch die im Rechtsstaatsprinzip verankerte Unschuldsvermutung der weiteren Aufbewahrung polizeilicher Unterlagen nicht entgegen (BVerfG, B.v. 16.5.2002 – 1 BvR 2257/01 – NJW 2002, 3231). Denn die Berücksichtigung von Verdachtsgründen stellt keine Schuldfeststellung oder -zuweisung dar, wenn und soweit sie bei Wiederholungsgefahr anderen Zwecken, insbesondere der vorbeugenden Straftatenbekämpfung, dient (BVerwG, U.v. 9.6.2010 – 6 C 5/09 – juris Rn. 26). Die Vermutung der Unschuld gilt nämlich bis zu einem etwaigen richterlichen Schuldspruch. Kommt es nicht dazu, gilt sie fort. Bei der Verfahrensbeendigung durch Einstellung oder bei einem Freispruch, der ausweislich der Gründe aus Mangel an Beweisen erfolgt, ist aber der Straftatverdacht wie dargestellt nicht notwendig ausgeräumt. Darf er Grundlage für Maßnahmen der weiteren Datenspeicherung sein, so steht die Unschuldsvermutung als solche dem nicht entgegen (vgl. hierzu BVerfG, B.v. 16.5.2002 – 1 BvR 2257/01 – NJW 2002, 3231).
(4) In diesem Sinne ist auch nicht zu beanstanden, dass der Beklagte von einer Wiederholungsgefahr beim Kläger hinsichtlich der Begehung zukünftiger Straftaten ausgeht, was eine fortgesetzte Speicherung der Daten zu bereits geführten Ermittlungsverfahren voraussetzt. Denn Art. 54 Abs. 2 S. 1 PAG verlangt tatbestandlich, dass die Speicherung der aus Ermittlungsverfahren gewonnenen Erkenntnisse zur Gefahrenabwehr, insbesondere zur vorbeugenden Straftatenbekämpfung erforderlich sein muss. Die Wiederholungsgefahr bzw. die Frage der Erforderlichkeit beurteilt sich dabei aber nicht allein deshalb als für den Kläger günstig, weil alle Ermittlungsverfahren eingestellt wurden (vgl. auch: BayVGH, B.v. 26.10.2004 – 24 ZB 04.1090 – BeckRS 2004, 30172 Rn. 33). Die Beurteilung einer Wiederholungsgefahr stellt sich vielmehr als eine Prognoseentscheidung dar, die deshalb mit gewissen Unsicherheiten behaftet ist, welche hinzunehmen sind. Bei der Prüfung einer Wiederholungsgefahr kommt es nach Überzeugung des Gerichts auch nicht darauf an, dass (sicher) zu prognostizieren ist, der Kläger werde gerade Straftaten zukünftig begehen, derentwegen er bereits in der Vergangenheit aufgefallen ist, also etwa, dass er hinreichend sicher erneut Verdächtiger in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Besitzes von kinderpornographischen Material sein wird. Eine solche Einschränkung des Erforderlichkeitsmerkmals sieht Art. 54 Abs. 2 S. 1 PAG seinem Wortlaut nach nicht vor. Entscheidend ist vielmehr die Gesamtbetrachtung der bisherigen ermittlungsrechtlichen Vita, der Persönlichkeit des Klägers und seinen Einlassungen zu den vorangegangenen Ermittlungsverfahren, wobei dem Beklagten dazu auch eine gewisse kriminalistische Erfahrung zugestanden werden muss (vgl. BayVGH, B.v. 18.7.2005 – 24 ZB 05.33 – BeckRS 2005, 16885 Rn. 16).
Dem Kläger ist zwar zuzugestehen, dass weder der Bescheid des LKA vom 8. September 2016 noch der streitgegenständliche Bescheid hierzu dezidierte und in Einzelheiten gehende Ausführungen konkret in Bezug auf die Prüfung einer Wiederholungsgefahr bzw. der Frage der Erforderlichkeit der weiteren Datenspeicherung enthalten. Das ist nur teilweise der Fall. Insbesondere die Ausführungen im Bescheid vom 8. September 2016 legen dem Wortlaut nach nahe, dass das LKA in erster Linie die Frage der Prüfung eines Resttatverdachtes bei den einzelnen Datensätzen in den gedanklichen Vordergrund gerückt hat. Gleichwohl verhalten sich sowohl jener bestandskräftige Bescheid als auch der streitgegenständliche Bescheid auch zur Frage der Erforderlichkeit bzw. der Wiederholungsgefahr bei einzelnen Ausführungen, etwa, wenn das LKA in seinen Bescheidsgründen bei einzelnen Datensätzen darauf verweist, dass sie vom Kläger in Ausnützung seiner dienstlichen Stellung als Polizeibeamter oder durch diese Stellung begünstigt bzw. mitbedingt begangen wurden (etwa das Aufbewahren von Dienstsiegeln im häuslichen Bereich, das unbefugte Abrufen von Daten über private Dritte von Dienstcomputern aus, das Ermöglichen einer Situation, in der Dritte unbefugt von dienstlichen Unterlagen Kenntnis erlangen) und vernünftige Gründe, die das Verhalten des Klägers rechtfertigen, nicht erkennbar seien. Jene Ausführungen zielen ihrem Argumentationsstrang nach weniger auf die Frage eines Resttatverdachts als vielmehr auf die Frage, ob das dem Kläger vorgeworfene Verhalten erklärbar ist und hieraus ein Schluss über zukünftiges Verhalten des Klägers im dienstlichen Bereich bzw. im Umgang mit dienstlichen Informationen und Materialien gezogen werden kann. Gerade dazu sah sich das LKA im Bescheid vom 8. September 2016 nicht in der Lage und erachtet die dort getroffene Einschätzung zur Frage der Erforderlichkeit auch in seinem Zweitbescheid vom 20. Februar 2020 weiterhin als richtig. Das wird im streitgegenständlichen Bescheid zum einen durch die Verwendung des Wortes „weiterhin“ am Schluss der einzelnen Bewertungen zur Frage der Löschung der Datensätze im KAN deutlich. Zum anderen zeigt der Beklagte im Bescheid vom 20. Februar 2020 in der Formulierung zu einzelnen Datensätzen (etwa zum Datensatz vom 14. Februar 2005 wegen Verletzung von Privatgeheimnissen – Ziffer 7.1.4 des Bescheids und zum Datensatz vom 4. Juni 2014 wegen Unterschlagung – Ziffer 7.1.9 des Bescheids) auch deutlicher auf, dass er sich bei seiner Beurteilung mit den Gesamtumständen zur Person des Klägers, seiner fortbestehenden dienstlichen Stellung und den damit verbundenen Zugriffsmöglichkeiten auf sensible Daten und schließlich auch zu dem Vortrag des Klägers im zweiten behördlichen Verwaltungsverfahren zur Frage einer Wiederholungsgefahr auseinandergesetzt, eine solche Wiederholungsgefahr aber nicht entkräftet gesehen hat. Das Gericht erachtet dies als noch ausreichend in der Begründung und unter Berücksichtigung des dem Beklagten verbleibenden Beurteilungsspielraums bei einer Prognoseentscheidung mit entsprechenden Unsicherheiten als rechtlich tragfähig. Den Ausführungen der Klägerseite, dass in allen Fällen verkannt worden sei, dass keine Wiederholungsgefahr vorgelegen habe, schließt sich das Gericht nicht an, zumal auch der Kläger dies im Ergebnis nur behauptet, dazu aber nichts substantiiert Neues vortragen lässt. Der Vorwurf, der Beklagte gründe seinen Bescheid bzw. die Fortsetzung der Speicherung der Datensätze im KAN nur auf Spekulationen, wird dem Ergebnis der strafrechtlichen Ermittlungen, wie es sich der vorgelegten Behördenakte und insbesondere den Wortlauten der entsprechenden Einstellungsverfügungen der Staatsanwaltschaft entnehmen lässt, nicht gerecht und verkennt, dass im Bereich der Gefahrenabwehr die Polizei eben nunmehr nicht an die Stelle der Aufsichtsbehörde über die Staatsanwaltschaft tritt, um deren Richtigkeit des Einstellungsergebnisses bzw. der Gründe der strafrechtlichen Einstellung noch einmal in allen Einzelheiten nachzuvollziehen. Dass im Einzelfall eine Aussage-gegen-Aussage-Konstellation bzw. eine Initiative der damaligen Ehefrau des Klägers im Hinblick auf die Erhebung strafrechtlicher Vorwürfe gegen den Kläger zugrunde gelegen haben mag, lässt die durchgeführten Ermittlungen und deren Abschluss nicht spekulativ erscheinen. Im Übrigen wurden die strafrechtlichen Ermittlungen durch objektive Anhaltspunkte begleitet, etwa das Auffinden dienstlicher Materialien im privaten Umfeld des Klägers, wobei unstreitig ist, dass der Kläger diese Gegenstände objektiv der Verfügungsgewalt der Dienststelle entzogen hat oder eben des Auffindens von inkriminierten Fotomaterial auf einem Rechner, zu dem auch der Kläger Zugriff gehabt hat. Worin also das Spekulative im Begründungsansatz des Beklagten liegen soll, bleibt dem Gericht verborgen.
Auch der Hinweis des Klägers auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (B.v. 1.6.2006 – 1 BvR 2293/03 = BeckRS 2009, 35816) verhilft dem klägerischen Begehren insoweit nicht zum Erfolg. Soweit das Bundesverfassungsgericht in seinem Judikat vom 1. Juni 2006 ausführt:
„Im Fall einer Verfahrenseinstellung nach § 170 Abs. 2 StPO bedarf es daher der Überprüfung, ob noch Verdachtsmomente gegen den Betroffenen bestehen, die eine Fortdauer der Speicherung zur präventiv-polizeilichen Verbrechensbekämpfung rechtfertigen. Weitere Voraussetzung der Datenspeicherung sind hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass der Betroffene zukünftig eine Straftat begehen wird. Deren Feststellung ist einer schematischen Betrachtung nicht zugänglich, sondern bedarf der eingehenden Würdigung aller hierfür relevanten Umstände des Einzelfalls unter Berücksichtigung der Gründe für die Einstellung des Verfahrens (vgl. BVerfG, 1. Kammer des Ersten Senats, Beschluss vom 16. Mai 2002 – 1 BvR 2257/01 -, NJW 2002, S. 3231 ).“,
teilt das Verwaltungsgericht den vorgegebenen Prüfungsmaßstab. Er entspricht den hier vorangestellten Anforderungen, dass der Beklagte eine Gesamtbetrachtung anzustellen hat. Das Gericht ist jedoch unter Berücksichtigung des Inhalts der vorgelegten Behördenakte und des Wortlauts des streitgegenständlichen Bescheids sowie auch des vorangegangenen Bescheids vom 8. September 2016 davon überzeugt, dass der Beklagte entsprechende Erwägungen und eine Abwägung angestellt hat, wenngleich auch die dazu gegebenen Bescheidsgründe als dürftig zu bezeichnen sind. Es ist jedoch – und darin scheint sich der hier zu beurteilende Sachverhalt zum Sachverhalt, der der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zugrunde gelegen hat, deutlich zu unterscheiden – ebenfalls in die Gesamtbetrachtung einzustellen, dass für eine Wiederholungsgefahr bzw. Erforderlichkeit der fortgesetzten Speicherung der Datensätze im KAN die Vielzahl der dem Kläger zur Last gelegten strafrechtlichen Vorwürfe, die in ihrer Gesamtheit eine immer wiederkehrende Vermischung auch von dienstlichen und privaten Angelegenheiten des Klägers nahelegen, spricht, die nicht nur auf ein singuläres Ereignis zurückgehen, sondern einen mehrjährigen Zeitraum der möglichen Begehung von Straftaten abdecken. In einem solchen Fall ist es von Rechts wegen auch unter Berücksichtigung des hohen Stellenwerts des dem Kläger zukommenden Grundrechts auf Wahrung seines allgemeinen Persönlichkeitsrechts in der Ausprägung als Recht auf informationelle Selbstbestimmung im Regelfall nicht zu beanstanden, wenn die Ausführungen zur Begründung einer Wiederholungsgefahr letztlich maßgeblich auch auf diese Vielzahl strafrechtlicher Vorwürfe über einen längeren Zeitraum abstellen.
Insoweit konnte sich der Beklagte nach Auffassung des Gerichts letztlich auch darauf beschränken, bei der Begründung zur Wiederholungsgefahr auf einzelne konkrete Datensätze abzustellen und solche Erwägungen nicht zu jedem einzelnen Datensatz in die Bescheidsgründe einzustellen. Es wird aus dem streitgegenständlichen Bescheid in der Zusammenschau mit dem bestandskräftigen Bescheid hinreichend deutlich, dass das LKA die Wiederholungsgefahr aus einer Gesamtbetrachtung von Anlasstaten, der (nach wie vor bestehenden) dienstlichen Stellung des Klägers und seinen Einlassungen im Rahmen der Verwaltungsverfahren sowie den Ermittlungsergebnissen in den jeweiligen Strafverfahren heraus begründet. Das hält nach Auffassung des Gerichts einer rechtlichen Prüfung stand.
(5) Die (Fortführung der) Speicherung erweist sich auch als verhältnismäßig, was sich aus einer Abwägung des öffentlichen Interesses an der Gefahrenabwehr und vorbeugenden Straftatbekämpfung mit dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung des Klägers ergibt. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass es sich um einen Datenspeicher handelt, der lediglich der Polizei zur Verfügung steht und die Speicherung im Kriminalaktennachweis grundsätzlich zeitlich befristet ist (Art. 54 Abs. 2 Satz 3 PAG). Im Hinblick auf den vom Kläger nach seinem Bekunden als besonders belastend empfundenen Datensatz über den Vorwurf des Besitzes von kinderpornographischen Material (Datensatz vom 18.2.2013) hat der Beklagte im Laufe des Gerichtsverfahrens dahingehend reagiert, dass er nach erneuter Überprüfung von einer 20-jährigen Speicherfrist Abstand genommen und diesen Datensatz der Regelspeicherfrist von zehn Jahren unterworfen hat, mit der Folge, dass die einheitliche Aussonderungsfrist für alle Datensätze – vorbehaltlich dessen, dass keine neuen Datensätze im KAN hinzutreten – nunmehr zehn Jahre gerechnet vom spätesten relevanten Eintrag beträgt. Die Mitteilung des Beklagten, dass diese Frist mit Ablauf des Jahres 2024 erreicht werde, ist rechnerisch korrekt. Das Gericht sieht vor diesem Hintergrund keine Veranlassung, die Frage der Verhältnismäßigkeit der Speicherfrist für den vorbezeichneten Datensatz einer besonders kritischen Würdigung zu unterziehen, da jedenfalls die nunmehr angesetzte Regelfrist von zehn Jahren auch vor dem Hintergrund der konkreten Erledigungsart jenes Ermittlungsverfahrens nicht zu beanstanden ist. Es ist schließlich offensichtlich weder die regelmäßige Aufbewahrungsfrist unter Berücksichtigung der Mitziehklausel (Art. 54 Abs. 2 Sätze 3 u. 6 i.V.m. Art. 53 Abs. 5 PAG) abgelaufen, noch liegt eine verkürzte, bis zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung bereits abgelaufene Speicherfrist nach Art. 54 Abs. 2 Satz 4 PAG vor, so dass im Übrigen auch Art. 62 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 PAG nicht einschlägig ist. Ob einzelnen Datensätzen im KAN Ermittlungsverfahren mit nur geringer Bedeutung zugrunde lagen (bspw. der Verstoß gegen das Urheberrechtsgesetz oder der Vorwurf der Urkundenfälschung im Zusammenhang mit der Verwendung einer eingescannten Unterschrift der damaligen Ehefrau des Klägers gegenüber dem Hausarzt) bedarf deshalb keiner eigehenden Bewertung, weil ausgehend von der vorgenannten Mitziehklausel und unter Berücksichtigung der jeweiligen zeitlichen Erfassung der Datensätze eine Verringerung der Gesamtspeicherfrist auch bei einer Absenkung der Regelspeicherfrist für einzelne Datensätze mit möglicherweise geringerem Bedeutungsgehalt auf fünf Jahre nicht in Betracht kommt.
Auch ist kein erheblicher Eingriff in das Persönlichkeitsrecht des Klägers dadurch zu sehen, dass seine Person bei entsprechenden Verdachtsmomenten bei künftigen Ermittlungsverfahren überprüft werden könnte bzw. dass der Kläger befürchtet, als Polizeibeamter berufliche Nachteile zu erleiden, insbesondere, soweit er meint, dass auch Vorgesetzte Zugriff auf die Datensätze nehmen könnten. Es ist dem Beklagten beizupflichten, dass der Kläger insoweit nicht anders behandelt werden kann als jeder sonstige von der Speicherung polizeirelevanter Daten betroffene Bürger. Die Fürsorgepflicht des Dienstherrn gebietet keine dem Beamten günstige Handhabung des Art. 54 PAG. Hierzu bedarf es offensichtlich keiner vertieften Ausführungen, zumal der Kläger sich diesbezüglich nur in allgemeinen und spekulativen Ausführungen ergeht.
(6) Ein Löschungsanspruch besteht auch nicht hinsichtlich der (nicht mit den Eintragungen im Kriminalaktennachweis korrespondierenden bzw. einen strafrechtlichen Anfangsverdacht gegen den Kläger betreffenden) sonstigen Eintragungen in der polizeilichen Vorgangsverwaltung IGVP (vgl. dazu Bl. 365 – 368 d. Behördenakte), die entweder eine Anzeigeerstattung durch den Kläger oder dessen Stellung als Zeuge oder Geschädigter in einem Ermittlungsverfahren gegen einen Dritten bzw. in einem Fall auch einen Ordnungswidrigkeitenvorgang gegen den Kläger dokumentieren. Ein Löschungsanspruch nach Art. 54 Abs. 2 Satz 2 PAG besteht schon deswegen nicht, weil der Kläger in diesen Fällen nicht Tatverdächtiger einer Straftat gewesen ist. Ein Löschungsanspruch kann auch nicht auf Art. 62 Abs. 2 PAG gestützt werden, weil die Daten im Sinne von Art. 62 Abs. 2 Satz Nr. 1 PAG rechtmäßig erhoben wurden. Die Datensätze werden bis zum Zeitpunkt der regelmäßigen Aussonderung auch im Sinne des Art. 62 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 PAG für die weitere Aufgabenerfüllung der Polizei benötigt (vgl. BayVGH, U.v. 21.1.2009 – 10 B 07.1382 – juris Rn. 43; B.v. 2.11.2020 – 10 C 20.2308 – BeckRS 2020, 30383 Rn. 9). Gegenteiliges hat der Kläger nicht mit durchgreifenden Argumenten aufgezeigt. Anhaltspunkte dafür, dass der Beklagte die regelmäßige Aussonderungsfrist von fünf Jahren für Vorgänge in der IGVP im Allgemeinen oder in den dem Kläger im Einzelnen betreffenden Fällen nicht beachtet, sind weder gerichtsbekannt, noch vorgetragen. Solche Anhaltspunkte ergeben sich insbesondere auch nicht aus der vorgelegten Behördenakte (vgl. Bl. 368 d. Behördenakte).
Soweit sich aus den Datensätzen im IGVP eine Stellung des Klägers als Anzeigeerstatter oder Zeuge entnehmen lässt, kann dem nämlich nur entnommen werden, dass der Kläger mit dem dargestellten Sachverhalt in irgendeiner Weise in Verbindung steht. Es handelt sich um bloße Informationen über Sachverhalte, wie sie sich aus der Sicht der Polizeidienststelle ereignet haben. Diese Informationen gewährleisten einen geordneten Dienstbetrieb und ermöglichen das spätere Wiederauffinden von Vermerken, Anfragen, Anzeigen usw. Die Daten stehen alleine der sie führenden Dienststelle zur Verfügung. Sollte gegen diese Vorgaben verstoßen werden, wäre die Weitergabe gegebenenfalls rechtswidrig – nicht aber die Speicherung der Daten (vgl. BayVGH, B.v. 25.1.2006 – 24 ZB 05.3074 – juris Rn. 36). Mit der Aufbewahrung derartiger Informationen ist somit keine nennenswerte Beeinträchtigung des Klägers verbunden (vgl. BayVGH, 21.1.2009 – 10 B 07. 1382 – juris Rn. 23, 35 f.). Der Kläger wird durch die weitere Vorhaltung von Daten, mit denen er in Verbindung gebracht werden kann, zudem nur in geringem Umfang belastet (vgl. OVG Lüneburg, U.v 30.1.2013 – 11 LC 470/10 – juris Rn. 47; VG München, GB v. 7.7.2020 – M 7 K 19.1311 – BeckRS 2020, 26154 Rn. 26).
Die Aufbewahrung solch rechtmäßig gespeicherter Vorgangsdaten für einen Zeitraum von fünf Jahren ist grundsätzlich gerechtfertigt (vgl. BayVGH, U.v. 21.12.2009 – 10 B 07.1382 – juris Rn. 36). Etwas anderes ergibt sich vorliegend auch nicht daraus, dass ein Löschungsanspruch ausnahmsweise bereits vor Ablauf der Speicherfrist besteht, wenn aus Anlass einer Einzelfallbearbeitung festgestellt wird, dass die Kenntnis der Daten für die speichernde Stelle zur Erfüllung der ihr obliegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich ist, da es nicht nur der Wortlaut des Gesetzes, sondern auch der verfassungsrechtliche Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebietet, den mit der Speicherung personenbezogener Daten verbundenen Eingriff in das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung sofort und nicht erst nach Ablauf einer bestimmten Frist zu löschen, wenn Daten für die polizeiliche Aufgabenerfüllung aller Voraussicht nach nicht mehr benötigt werden (vgl. BayVGH, U.v. 21.12.2009 – 10 B 07.1382 – juris Rn. 36). Die im IGVP gespeicherten Daten sind für Polizeibeamte nicht allgemein verfügbar. Vielmehr bedarf es hierzu einer konkreten Berechtigung im Einzelfall. Ein Sachbearbeiter auf unterer Ebene hat nur Zugriff auf die Daten seiner Polizeiinspektion. Soweit Kriminalpolizisten leitende Aufgaben wahrnehmen, haben sie eine größere Berechtigung, die sich aber auch nur auf ihren räumlichen Aufgabenbereich bezieht. Angesichts dessen ist der mit der Speicherung von Daten im IGVP verbundene Eingriff in das Recht des Klägers auf informationelle Selbstbestimmung nach Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG als so gering anzusehen, dass ein Anspruch auf Löschung dieser Daten vor Ablauf der Fünf-Jahres-Frist in der Regel nicht besteht (vgl. VG München, U.v. 10.12.2014 – M 7 K 12.1563 – juris Rn. 48). Soweit der Kläger gleichwohl befürchtet, Vorgesetzte und sonstige Kollegen könnten durch (unbefugten) Abruf der Datensätze negative Erkenntnisse über ihn gewinnen bzw. ein für ihn dienstlich nachteiliges Verhalten von Vorgesetzten mit sich bringen, so ist der Kläger insoweit auf die beamtenrechtlichen Fürsorgemöglichkeiten zu verweisen. Es ist jedenfalls nicht vom Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens umfasst und nicht Aufgabe des erkennenden Gerichts, diesen dem Kläger aus seinem beamtenrechtlichen Verhältnis erwachsenden Anspruch auf Schutz und Fürsorge durch seinen Dienstherrn für das weitere berufliche Fortkommen des Klägers quasi an Stelle des Dienstherrn wahrzunehmen.
(7) Schließlich folgt auch aus dem Grundrecht des Klägers auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) kein weitergehender Löschungsanspruch (vgl. BayVGH, B.v. 24.2.2015 – 10 C 14.1180 – juris Rn. 22 m.w.N.). Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das vor der unbegrenzten Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe persönlicher Daten schützt, ist nicht schrankenlos gewährleistet und findet in den Regelungen der jeweiligen Landespolizeigesetze für den Bereich der Polizeidaten und Kriminaldaten in Art. 54 Abs. 2 Satz 2 PAG und Art. 62 Abs. 2 Satz 1 PAG eine verfassungsmäßige Grenze (vgl. BayVGH, B.v. 1.8.2012 – 10 ZB 11.2438 – juris Rn. 7). Aus dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung ergäbe sich ein Anspruch auf Löschung der über den Betroffenen gespeicherten polizeilichen Daten daher nur, soweit deren Aufbewahrung und Speicherung nicht durch diese gesetzlichen Grundlagen gerechtfertigt wäre (vgl. BayVGH, B.v. 24.2.2015 – 10 C 14.1180 – juris Rn. 22). Dies ist hier jedoch nicht der Fall.
cc) Aus den vorgenannten Gründen muss auch der Antrag des Klägers auf Berichtigung der über ihn gespeicherten Daten (Art. 62 Abs. 1 PAG), den er hilfsweise für den Fall der Rechtmäßigkeit der fortgesetzten Speicherung geltend macht, erfolglos bleiben. Für eine Korrekturbedürftigkeit einzelner Datensätze bzw. innerhalb dieser Datensätze von einzelnen Daten (bspw. vom Merkmal „Beschuldigter“ zum Merkmal „Zeuge“ o.ä.) hat er nichts Durchgreifendes vorgetragen. Insbesondere rechtfertigt die korrekte Annahme eines jeweils fortbestehenden Resttatverdachtes auch die Speicherung des Merkmals „Beschuldigter in einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren“. Da der Kläger im vorliegenden Verfahren nicht verlangen kann, dass die einzelnen Einstellungsverfügungen der Staatsanwaltschaft durch das Verwaltungsgericht noch einmal dezidiert daraufhin untersucht werden, ob eine Täterschaft des Klägers in den jeweiligen Fällen aufgrund seines umfangreichen Sachvortrags tatsächlich nicht in Betracht zu ziehen ist, ergibt sich insoweit auch kein Berichtigungsanspruch. Im Übrigen würde in einem solchen Fall auch der Löschungsanspruch für Datensätze, die im KAN bzw. korrespondierend im IGVP gespeichert sind, vorrangig eingreifen.
Für weitergehenden Korrekturbedarf einzelner Datensätze hat der Kläger nichts vorgetragen. Insbesondere ergibt sich ein solcher Berichtigungsbedarf nach Auffassung des Gerichts auch nicht im Hinblick auf die einzelnen Speicherfristen, was vorgehend bereits dargelegt wurde.
dd) Schließlich steht dem Kläger auch kein Anspruch dahingehend zu, den Beklagten zu verpflichten, bei den Datensätzen, die im KAN über den Kläger gespeichert sind, einen sog. Satzschutz zu setzen. Die diesbezügliche Ablehnung des Beklagten erweist sich insbesondere nicht als ermessensfehlerhaft (§ 114 S. 1 VwGO).
Bei dem vom Kläger thematisierten Satzschutz handelt es sich nach unwidersprochener Darstellung des Beklagtenvertreters in der mündlichen Verhandlung um eine programmtechnische Sperrmöglichkeit für Datensätze im IGVP, die es erlaubt, die Sicht auf bestimmte elektronisch geführte Datensätze in personeller Hinsicht, d.h. für den Zugriff durch Sachbearbeiter und Vorgesetzte, einzuschränken. Der Beklagtenvertreter hat dazu nachvollziehbar weiter ausgeführt, dass ein solcher Satzschutz regelmäßig in der elektronischen Datenbank der Polizeidienststelle dann wieder entfernt wird, wenn der Vorgang abgeschlossen ist. Ein Satzschutz für elektronisch geführte Datensätze in der KAN-Datenbank sei nicht vorgesehen, da dies zu einer Löschung der KAN-Datensätze durch die Hintertür führen würde. Dieser Darstellung ist der Kläger nicht substantiiert entgegengetreten – was ihm nach Überzeugung des Gerichts aufgrund seiner dienstlichen Stellung und Erfahrung grundsätzlich möglich gewesen wäre -, sondern hat darauf beharrt, dass das Setzen eines Satzschutzes dem Beklagten auch für KAN-Datensätze möglich sein und im Fall des Klägers Anwendung finden müsse.
Die Möglichkeit eines Satzschutzes als technisches Instrument der Einschränkung der Datenverarbeitung von IGVP-Datensätzen in Form eines „Sichtschutzes“ für Angehörige der sachbearbeitenden Polizeidienststelle ist demnach eine Maßnahme des „inneren“ Datenschutzes, also der Sicherung persönlicher Daten über Dritte durch unbefugte Einsichtnahme von Polizeiangehörigen. Sie vermittelt zunächst keine Außenwirkung für den Bürger. Der von der Datenverarbeitung und -speicherung Betroffene kann ein Begehren auf Setzen eines solchen Satzschutzes nicht auf eine landesgesetzliche Regelung stützen, die speziell einen solchen Satzschutz zum Regelungsgegenstand hat. Art. 62 Abs. 4 Satz 3 PAG, wonach Daten in der Verarbeitung eingeschränkt werden, wenn ihre Richtigkeit nicht erwiesen werden kann, greift vorliegend ersichtlich nicht ein. Auch Art. 62 Abs. 1 Satz 6 PAG, wonach Daten, die nicht unverzüglich gelöscht werden können, unverzüglich in der Bearbeitung einzuschränken sind, ist keine für das Begehren des Klägers taugliche Anspruchsgrundlage. Diese Vorschrift setzt nämlich in systematischer Stellung zu den weiteren Regelungen des Absatzes 1 des Art. 62 PAG voraus, dass sich personenbezogene Daten, die der Polizei übermittelt wurden, als unrichtig erweisen. Auch dies ist in Bezug auf die Datensätze über den Kläger im KAN nicht der Fall. Schließlich greifen auch keine Regelungen des Bayerischen Datenschutzgesetzes, der StPO oder der DSGVO ein, da sie durch die polizeirechtlichen Datenverarbeitungsvorschriften des PAG verdrängt werden (vgl. Art. 1 Abs. 5 BayDSG, § 483 Abs. 3 StPO, Art. 2 Abs. 2 lit. d) DSGVO).
Auch auf Verfassungsrecht unmittelbar kann der Kläger sein Begehren nicht mit Erfolg stützen. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts soll der Einzelne gegen jede Form der Preisgabe und Verwendung persönlicher Daten geschützt werden (BVerfG, „Volkszählungsurteil“ U.v. 15.12.1983 – 1 BvR 209/83 – NJW 1984, 419). Anknüpfungspunkt des Bundesverfassungsgerichts ist dabei nicht das Recht des Einzelnen auf Achtung seines Privatlebens, sondern auf seine Datenhoheit als Bestandteil seiner individuellen Entfaltung. Folglich muss der Einzelne nicht nur vor unzulässigen Eingriffen in seine Rechte, sondern auch bereits vor Einschüchterungseffekten durch eine umfassende und anlasslose Bevorratung sensibler Daten über jedermann geschützt werden (BVerfG, B.v. 11.3.2008 – 1 BvR 256/08 – NVwZ 2008, 543). Für das Bundesverfassungsgericht gibt es überdies keine belanglosen Daten. In der Konsequenz fordert das Gericht eine strenge Zweckbindung der Daten, eine eindeutige Zweckfestlegung im Voraus der Verarbeitung und einen klaren Wortlaut eingreifender Gesetze, wobei es dem Bestimmtheitsgebot entscheidende Bedeutung zumisst (BVerfG, B.v. 11.3.2008 a.a.O.). Abwägungstopoi bilden neben einer möglichen Einschüchterung der Bevölkerung insbesondere Anlass, Streubreite und Heimlichkeit von Datenverarbeitungsmaßnahmen (Leeb/Liebhaber, Grundlagen des Datenschutzrechts, JuS 2018, 534). Die Datenverarbeitung hat daher dem Vorbehalt und dem Vorrang des Gesetzes zu entsprechen. Im Bereich des Gefahrenabwehrrechts der Polizeien der Länder bieten dabei jedoch die entsprechenden Datenschutzregelungen in den Polizeigesetzen eine hinreichende Rechtsgrundlage für den Eingriff in das individuelle Recht des Einzelnen auf informationelle Selbstbestimmung (vgl. auch speziell zur alten Fassung des PAG: BayVerfGH, Entscheidung vom 19.10.1994 – Vf. 12-VII/92 u.a. – NVwZ 1996, 166). Soweit also in Datenschutzbelange eines Betroffenen eingegriffen werden soll, muss sich das entsprechende Verhalten der Polizeibehörde an den Datenschutzbestimmungen des jeweiligen Landespolizeigesetzes, in Bayern also dem PAG messen lassen. Die Setzung eines Satzschutzes, wie er Gegenstand des klägerischen Begehrens ist, ist nun aber kein Eingriff in die Datenschutzbelange des Betroffenen, denn mit dem Satzschutz werden Daten nicht erhoben oder zum (möglichen) Nachteil des Betroffenen verarbeitet. Der Satzschutz versteht sich als eine Möglichkeit, innerhalb der für die Datenverarbeitung zuständigen Polizeibehörde eine Einengung des Kreises der Zugriffsberechtigten vorzunehmen, was demnach als eine Form der Beschränkung der Datenverarbeitung im Sinne des Art. 62 PAG zu verstehen ist. Es besteht vor diesem Hintergrund, dass eine grundsätzliche landesrechtliche Regelung auch zur Beschränkung einer Datenverarbeitung bei ansonsten fortgesetzter Speicherung besteht kein Bedürfnis und keine Veranlassung, aus dem Verfassungsrecht selbst unmittelbar weitergehende Rechte eines Betroffenen zu statuieren. Denn jedenfalls hat der Kläger weder behauptet noch aufgezeigt, dass die in seinen Fällen datenspeichernde Polizeibehörde grundsätzlich und allgemein regel- oder weisungswidrig die Datenschutzbestimmungen zum Umgang mit seinen persönlichen Daten missachtet bzw. sonst ein nachvollziehbares Bedürfnis besteht, auch über die einfachgesetzlichen Regelungen im PAG zur Datenverarbeitung hinaus einen Anspruchstatbestand für eine die Datenverarbeitung einschränkende Maßnahme herzuleiten. Der Kläger stützt seinen diesbezüglichen Antrag lediglich auf allgemein gehaltene Befürchtungen, denen jedoch im Rahmen dienstaufsichtsrechtlicher und ggf. auch datenschutzaufsichtsrechtlicher Maßnahmen beizukommen ist, so dass für das Gericht keine verfassungswidrige Lücke in den einfachgesetzlichen Regelungen erkennbar ist, die nur durch die ergänzende Heranziehung von unmittelbarem Verfassungsrecht zu schließen wäre. Das Setzen eines Satzschutzes ist auch kein den Betroffenen belastendes Eingriffsverhalten der Polizei, sondern dient gerade dem Schutz des Betroffenen. Das Unterlassen bzw. die Ablehnung des Setzens eines solchen Satzschutzes wiederum rechtfertigt nicht, dass der Landesgesetzgeber hierzu eine spezielle gesetzliche Regelung zu treffen hätte, so dass es der ergänzenden Heranziehung verfassungsrechtlicher Regelungen bedarf, solange dieser Zustand der „Gesetzlosigkeit“ nicht beseitigt ist. Denn wie bereits ausgeführt ist das Instrument des Satzschutzes zunächst eine Maßnahme des innerorganisatorischen Datenschutzes ohne direkte Außenwirkung im Verhältnis zum Bürger. Dieser wird vielmehr bei einem unterlassenen Satzschutz erst dadurch in seinen datenschutzrechtlichen Belangen betroffen, wenn die jeweiligen Amtswalter Zugriff auf seine Daten nehmen, ohne hierzu berechtigt zu sein. Dem aber wäre, wie auch bereits angeführt, zunächst primär durch dienstaufsichts- und datenschutzaufsichtsrechtliche Maßnahmen zu begegnen und würde sich ein Handlungsbedarf für den Gesetzgeber erst dann ergeben, wenn erkennbar die bestehenden Instrumente zum innerorganisatorischen Datenschutz nicht ausreichten bzw. keine Wirkung zeitigten. Das ist nicht erkennbar.
Nachdem es also einer Heranziehung verfassungsrechtlicher Normen zur Anspruchsbegründung nicht bedarf und die bestehenden einfachgesetzlichen Regelungen im Fall des Klägers nicht erfüllt sind, um sein Begehren zu stützen, hat das Gericht aufgrund der Bescheidung des Antrages des Klägers auf Einrichtung eines Satzschutzes durch den Beklagten im streitgegenständlichen Bescheid gleichwohl weiter zu untersuchen, ob sich im Fall des Klägers jedenfalls aus einer Selbstbindung der Verwaltung der bayerischen Polizeibehörden im Umgang mit der Anwendung eines Satzschutzes ein Anspruch auf Gewährung dieses Satzschutzes ergibt. Ein solcher Anspruch ist seiner Natur nach aber nur auf eine ermessensgerechte Entscheidung über das Begehren des Klägers gerichtet. Das Gericht prüft daher lediglich eingeschränkt, ob es eine dem Klägerbegehren günstige Verwaltungspraxis des Beklagten gibt, bejahendenfalls ob dem Kläger gleichheitswidrig (Art. 3 GG) die gleichartige Anwendung dieser Verwaltungspraxis versagt wurde und ob ggf. ein atypischer Fall vorliegt, der auch entgegen einer allgemeinen Verwaltungspraxis ausnahmsweise zur Zuerkennung der begehrten Maßnahme führt.
Hier fehlt es jedoch schon an einer allgemeinen Verwaltungspraxis des Beklagten auf Anwendung des Satzschutzes im Bereich der KAN-Datensätze, wie der Beklagtenvertreter in der mündlichen Verhandlung schlüssig und nachvollziehbar dargelegt hat. Der Kläger kann daher nicht verlangen, dass der Beklagte in seinem Fall programmtechnisches Neuland betritt, zumal dies nach Bekunden der Beklagtenseite zu einer Realisierung des klägerischen Hauptantrages auf Löschung der KAN-Datensätze führen würde, worauf der Kläger nach den Ausführungen des Gerichts in diesem Urteil gerade keinen Anspruch hat. Es ist daher vonseiten des Beklagten im streitgegenständlichen Bescheid auch nicht ermessensfehlerhaft, dies dem Kläger ohne tiefergehende Begründung zu versagen. Denn insoweit wohnt der Versagung ein intendiertes Ermessen inne.
Schließlich erkennt das Gericht auch keinen atypischen Fall. Allein der Umstand, dass der Kläger ebenfalls Polizeibeamter beim Beklagten ist und die Möglichkeit besteht, dass Kollegen des Klägers sich über einen unbefugten Abruf der Daten Erkenntnisse zum Kläger verschaffen, genügt nicht für die Etablierung eines atypischen Falles. Auch die Frage, ob dem Kläger das berufliche Fortkommen in Form einer noch möglichen weiteren Beförderung versagt sein kann, wenn inkriminierende Daten über ihn bei seinem Dienstherrn gespeichert sind, ist in dieser Allgemeinheit nicht geeignet, einen atypischen Fall zu begründen. Denn dabei ist jedenfalls in die Abwägung einzustellen, dass die Datenerhebung und -speicherung auf ein Verhalten des Klägers im weiteren Sinne zurückgehen, nämlich dadurch, dass er Anlass zu strafrechtlichen Ermittlungen durch sein – im Einzelnen von ihm gar nicht bestrittenes – Verhalten gegeben hat.
Da Ermessensfehler vom Kläger auch sonst nicht aufgezeigt wurden, besteht nach alledem kein Anspruch auf Setzen eines Satzschutzes oder auf Verurteilung des Beklagten zur Neuverbescheidung dieses Anliegens.
Die Klage ist vielmehr mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO insgesamt abzuweisen.