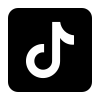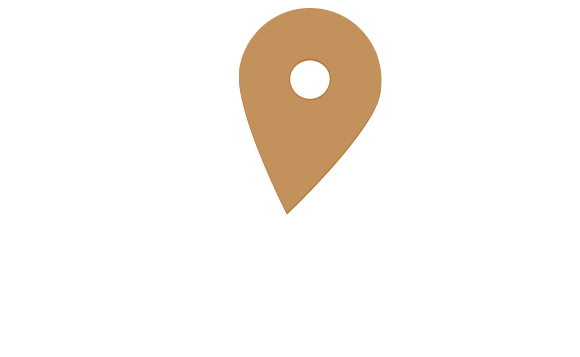Aktenzeichen M 6 K 17.31009
Leitsatz
1. Die Beurteilung, ob eine Fluchtalternative iSd § 3e Abs. 1 AsylG besteht, hängt maßgeblich davon ab, in welchem Ausmaß ein Betroffener vorverfolgt ist und wie sehr er ins Visier seiner Verfolger gelangt ist (vgl. BayVGH BeckRS 2017, 103942). Hat ein afghanischer Asylbewerber selbst nie aktiv gegen die Taliban gearbeitet oder deren Gegner unterstützt, ist er nicht als hochrangiges Angriffsziel für die Taliban aufgrund einer angeblich gedrohten Zwangsrekrutierung anzusehen. (Rn. 29) (redaktioneller Leitsatz)
2. Die Anforderungen an eine nachvollziehbare Schilderung der eigenen sexuellen Neigung des Asylbewerbers bei Geltendmachung einer drohenden Verfolgung iSd § 3 Abs. 1 AsylG aufgrund homosexueller Neigung dürfen nicht überspannt werden, wobei insbesondere das Alter und die Herkunft des Asylbewerbers zu berücksichtigen sind. (Rn. 33) (redaktioneller Leitsatz)
3. Das Risiko, in der in Afghanistan liegenden Herkunftsprovinz Paktya, oder in Kabul durch Anschläge Schaden an Leib oder Leben zu erleiden, liegt nach den hierfür von der Rechtsprechung entwickelten Maßstäben weit unter der beachtlichen Wahrscheinlichkeit, sodass eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit des Schutzsuchenden iSd § 4 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 AsylG nicht angenommen werden kann. (Rn. 42 – 48) (redaktioneller Leitsatz)
4. Nach ständiger Rechtsprechung des BayVGH ist davon auszugehen, dass die allgemeine bzw. humanitäre Lage in Afghanistan derzeit für aus dem europäischen Ausland zurückkehrende, männliche, arbeitsfähige afghanische Staatsangehörige nicht so ernst ist, dass eine Abschiebung ohne Weiteres eine Verletzung von Art. 3 EMRK bedeuten würde (vgl. BayVGH BeckRS 2017, 107815). (Rn. 52) (redaktioneller Leitsatz)
Tenor
I. Die Klage wird abgewiesen.
II. Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.
III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar.
Gründe
1. Über den Rechtsstreit konnte aufgrund der mündlichen Verhandlung am 29. November 2017 entschieden werden, obwohl auf Seiten der Beklagten niemand erschienen ist. In der Ladung zur mündlichen Verhandlung wurde darauf hingewiesen, dass im Falle des Nichterscheinens eines Beteiligten auch ohne ihn verhandelt und entschieden werden könne (§ 102 Abs. 2 Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO). Die Beklagte hat mit allgemeiner Prozesserklärung auf Einhaltung der Ladungsfrist sowie Ladung gegen Empfangsbekenntnis verzichtet.
2. Die zulässige Klage ist unbegründet. Der Bescheid ist, soweit er angegriffen wird, rechtmäßig und verletzt die Kläger nicht in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1, Abs. 5 VwGO). Der Kläger hat weder Anspruch auf Zuerkennung von Flüchtlingsschutz noch auf Zuerkennung subsidiären Schutzes. Auch einen Anspruch auf Feststellung eines nationalen Abschiebungsverbots besteht nicht.
Maßgeblicher Zeitpunkt zur Beurteilung der Sach- und Rechtslage ist derjenige der mündlichen Verhandlung am 29. November 2017 (§ 77 Abs. 1 Satz 1 Asylgesetz – AsylG).
Zur Begründung wird zunächst auf die tatsächlichen und rechtlichen Ausführungen der Beklagten im Bescheid vom 12. Januar 2017 voll inhaltlich Bezug genommen und diese zum Gegenstand der vorliegenden Entscheidung gemacht (§ 77 Abs. 2 AsylG). Ergänzend wird ausgeführt:
2.1 Der Kläger hat keinen Anspruch auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach § 3 Abs. 1 AsylG.
Nach § 3 Abs. 1 AsylG ist einem Ausländer die Flüchtlingseigenschaft im Sine des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl. 1953 II S. 559) – Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) – zuzuerkennen, wenn er sich aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe außerhalb des Landes (Herkunftsland) befindet, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt und dessen Schutz er nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Furcht nicht in Anspruch nehmen will oder in dem er als Staatenloser seinen vorherigen gewöhnlichen Aufenthalt hatte und in das er nicht zurückkehren kann oder wegen dieser Furcht nicht zurückkehren will.
Bei der Prüfung, ob dem Ausländer Verfolgung droht, ist der asylrechtliche Prognosemaßstab der beachtlichen Wahrscheinlichkeit anzulegen (BVerwG, U.v. 27.4.2010 – 10 C 5/09 – juris Rn. 18 ff.). Im Falle einer Vorverfolgung privilegiert Art. 4 Abs. 4 der Richtlinie 2011/95/EU („Qualifikationsrichtlinie“) den Vorverfolgten bzw. Geschädigten durch die (widerlegbare) Vermutung, dass sich eine frühere Verfolgung oder Schädigung bei einer Rückkehr in das Herkunftsland wiederholen wird. Ob die Vermutung durch „stichhaltige Gründe“ widerlegt ist, obliegt tatrichterlicher Würdigung im Rahmen freier Beweiswürdigung (BVerwG, U.v. 27.4.2010 a.a.O.).
Das Gericht muss dabei jedoch die volle Überzeugung von der Wahrheit – und nicht etwa nur von der Wahrscheinlichkeit – des vom Asylsuchenden behaupteten individuellen Schicksals und hinsichtlich der zu treffenden Prognose, dass dieses die Gefahr einer Verfolgung begründet, erlangen. Angesichts des typischen Beweisnotstandes, in dem sich Asylsuchende insbesondere hinsichtlich asylbegründender Vorgänge im Herkunftsstaat befinden, kommt dem persönlichen Vorbringen des Asylsuchenden und dessen Würdigung für die Überzeugungsbildung besondere Bedeutung zu. Zur Asylanerkennung kann schon allein der Tatsachenvortrag des Asylsuchenden führen, sofern seine Behauptung unter Berücksichtigung aller sonstigen Umstände in dem Sinne „glaubhaft“ sind, dass sich das Tatsachengericht von seiner Wahrheit überzeugen kann (BVerwG, U.v. 16.4.1985 – 9 C 109/84 – juris Rn. 16 f.).
Demgemäß setzt die Feststellung der Flüchtlingseigenschaft voraus, dass der Asylsuchende den Sachverhalt, der seine Verfolgungsfurcht begründen soll, schlüssig darlegt. Dabei obliegt es ihm, unter Angabe von Einzelheiten und gegebenenfalls unter Ausräumen von Widersprüchen und Unstimmigkeiten einen in sich stimmigen Sachverhalt zu schildern, der geeignet ist, das Asylbegehren lückenlos zu tragen. Auf die Glaubhaftigkeit seiner Schilderung und die Glaubwürdigkeit seiner Person kommt es entscheidend an. Der Asylbewerber muss die persönlichen Umstände seiner Verfolgung und Furcht vor einer Rückkehr hinreichend substantiiert, detailliert und widerspruchsfrei vortragen, er muss kohärente und plausible wirklichkeitsnahe Angaben machen.
Nach diesen Grundsätzen hat der Kläger keinen Anspruch auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft. Er konnte nicht im dargestellten Sinne glaubhaft machen, dass ihm eine Verfolgung im Sinne des § 3 Abs. 1 AsylG droht.
2.1.1 Soweit der zum Zeitpunkt der angeblichen Verfolgung noch minderjährige Kläger sich darauf beruft, dass sein Bruder durch die Taliban getötet worden sei, weil er die Schule besucht habe, und ihm selbst die Rekrutierung durch die Taliban gedroht habe, steht eine Verfolgung des Klägers im Sinne des § 3 Abs. 1 AsylG nicht zur Überzeugung des Gerichts fest.
Zwar hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in einer jüngeren Entscheidung die Zwangsrekrutierung Minderjähriger als eine kinderspezifische Form von Verfolgung im Sinne von Art. 1 A Nr. 2 GFK und damit als eine gegen Kinder gerichtete Verfolgungshandlung im Sinne von § 3a Abs. 2 Nr. 6 AsylG angesehen (vgl. BayVGH, U.v. 23.3.2017 – 13a B 17.30011 – juris Leitsatz Nr. 1). Das Vorbringen des – inzwischen volljährigen – Klägers zu seiner angeblich drohenden Zwangsrekrutierung ist jedoch nicht glaubhaft. Dem Kläger ist es nicht gelungen, sein angebliches Verfolgungsschicksal schlüssig und im Wesentlichen widerspruchsfrei darzulegen.
Bereits die Schilderung der Bedrohung seines Bruders gegenüber dem Bundesamt auf der einen und dem Gericht auf der anderen Seite weicht in wesentlichen Punkten voneinander ab. Bei seiner Anhörung vor dem Bundesamt gab der Kläger zunächst an, sein Bruder sei vor seiner Entführung zweimal von den Taliban gewarnt worden. Im weiteren Verlauf gab er an, sein Bruder sei die beiden Male, als die Taliban erschienen seien, nicht zu Hause gewesen, sondern sein Vater habe jeweils die Tür geöffnet. Auf entsprechenden Vorhalt des Bundesamts hin änderte der Kläger seine Aussage dann dahingehend ab, sein Vater habe seinem Bruder die Drohungen weitergesagt. In der mündlichen Verhandlung gab der Kläger an, dass er nicht wisse, ob sein Bruder vor der Entführung durch die Taliban von diesen bedroht worden sei. Auf Vorhalt des Gerichts, dass er gegenüber dem Bundesamt angegeben habe, sein Bruder sei zweimal gewarnt worden, führte der Kläger aus, die Taliban hätten seinem Bruder in der Religionsschule gesagt, dass er nicht in die offizielle staatliche Schule gehen solle. Auf Vorhalt seines Prozessbevollmächtigten, dass er beim Bundesamt angegeben habe, dass der Vater dem Bruder gesagt habe, er solle nicht zur Schule gehen, ließ der Klägers sich dahingehend ein, er vermute, dass es zunächst die Taliban seinem Vater und dieser dann seinem Bruder gesagt habe. Gründe für diese wechselnden Darstellungen gab der Kläger nicht an.
Auch die Umstände seiner eigenen Bedrohung konnte der Kläger nicht widerspruchsfrei schildern. Nach seinen Angaben gegenüber dem Bundesamt soll er an dem Tag aufgefordert worden zu sein, sich innerhalb der nächsten Woche bei den Taliban einzufinden, an dem die Taliban den Leichnam seines zwei Wochen zuvor entführten Bruders zu seinen Eltern nach Hause brachten. Während der Kläger gegenüber dem Bundesamt angab, die Taliban seien morgens gekommen und hätten die Tür geöffnet, woraufhin seine Eltern ihn schnell versteckt hätten, gab der Kläger in der mündlichen Verhandlung an, die Taliban seien am Nachmittag gekommen und hätten an die Tür geklopft. Am Klopfen hätten die Eltern erkannt, dass es sich um die Taliban handelte, und hätten ihn aufgefordert, sich zu verstecken. Während der Kläger gegenüber dem Bundesamt angab, der Vater habe noch am gleichen Tag einen Fluchtplan mit ihm ausgearbeitet, äußerte er in der mündlichen Verhandlung, er wisse nicht mehr, wann er sich entschlossen habe, Afghanistan zu verlassen. Erst auf richterlichen Vorhalt seiner Aussage vor dem Bundesamt gab der Kläger an, sein Vater habe ihm an dem Tag, als der Leichnam seines Bruders gebracht worden sie, zur Flucht geraten. Am nächsten Tag, hätten sie dann beschlossen, dass er das Land verlassen müsse und einen entsprechenden Plan gefasst. Auch den Umstand, dass die Eltern angeblich von den Taliban geschlagen worden seien, erwähnt der Kläger in der mündlichen Verhandlung erst auf entsprechende Nachfrage hin.
Abgesehen von diesen Ungereimtheiten, für die der Kläger keine bzw. keine nachvollziehbare Erklärung abgegeben hat, erstaunt es vor allem, dass der Kläger zu dem Zeitpunkt seiner angeblichen Bedrohung keine stimmigen Angaben machen kann. So gab er zunächst an, dass er nicht wisse, wann die Taliban seinen toten Bruder brachten. Er wisse nur, dass es an einem Nachmittag gewesen sei. Auf die Frage seines Prozessbevollmächtigten erklärte er, zwischen diesem Vorfall mit den Taliban und seiner Ausreise aus Afghanistan im Februar 2014 könnten etwa eineinhalb bis zwei Monate gelegen haben. Die Wahrheit dieser Aussage unterstellt, hätten die Taliban den Leichnam seines Bruders seinen Eltern also im Dezember 2013 übergeben. Der Kläger erklärte dann aber weiter, der Vorfall habe sich im Frühling ereignet, und blieb schließlich – nachdem er vorgebracht hat, dass er nicht wisse, wann Frühling in Afghanistan sei – letztlich bei seiner ursprünglichen Aussage, dass er den Zeitpunkt nicht kenne. Dem Gericht ist bewusst, dass die Anforderungen an eine schlüssige Schilderung des Verfolgungsschicksals insbesondere angesichts des Alters des Klägers, seiner Herkunft, seiner fehlenden Schulbildung und des inzwischen mehr als dreieinhalb Jahre zurückliegenden Vorfalls nicht überstrapaziert werden dürfen. Gleichwohl erscheint es nicht nachvollziehbar, dass der Kläger zu einem derart einschneidenden Erlebnis, wie es die Kenntniserlangung vom gewaltsamen Tod des eigenen Bruders für einen Jugendlichen darstellen muss, keinen stimmigen Angaben machen kann und selbst die Angabe der Tageszeit „(an einem Nachmittag“), bei der sich der Kläger angeblich sicher ist, gegenüber der ursprünglichen Schilderung gegenüber dem Bundesamt („Morgens“) noch abweicht. Auch unter Berücksichtigung der oben genannten Umstände wäre aus Sicht des Gerichts zu erwarten gewesen, dass der Kläger hierzu zumindest ungefähre Angaben machen kann, etwa eine Jahreszeit angeben oder einen zeitlichen Bezug zu einem anderen Ereignis herstellen kann, zumal er durchaus zeitlich orientiert zu sein scheint, wenn er angibt, dass zwischen Entführung und Übergabe des Leichnams zwei Wochen gelegen hätten und er sich vor seiner Einreise nach Deutschland im April 2014 zwei Monate auf der Flucht befunden habe. Vor diesem Hintergrund erscheint auch seine Aussage, dass er nicht wisse, wann in Afghanistan Frühling sei, wenig glaubhaft, zumal viel dafür spricht, dass der Kläger, der seinen eigenen Angaben zufolge seinem Vater beim Hüten von Kleinvieh geholfen hat, durchaus über rudimentäre Kenntnisse der für den Betrieb einer Landwirtschaft nicht unerheblichen Jahreszeiten hat.
Selbst wenn zugunsten des Klägers eine Vorverfolgung durch die Taliban als wahr unterstellt würde, kann ihm kein Flüchtlingsstatus zuerkannt werden, weil jedenfalls eine innerstaatliche Schutzalternative besteht. Dem inzwischen volljährigen Kläger kann zugemutet werden, sich in einer der hinreichend sicheren Städte wie Kabul niederzulassen und in der Anonymität der Großstadt Schutz zu suchen.
Gemäß § 3e Abs. 1 AsylG wird einem Ausländer die Flüchtlingseigenschaft nicht zuerkannt, wenn er in einem Teil seines Heimatlandes keine begründete Furcht vor Verfolgung oder Zugang zu Schutz vor Verfolgung hat und er sicher und legal in diesen Landesteil reisen kann, dort aufgenommen wird und vernünftigerweise erwartet werden kann, dass er sich dort niederlässt.
Die Beurteilung, ob eine Fluchtalternative besteht, hängt insoweit maßgeblich davon ab, in welchem Ausmaß ein Betroffener vorverfolgt ist und wie sehr er ins Visier seiner Verfolger gelangt ist (BayVGH, B.v. 14.2.2017 – 13a ZB 17.30010 – juris Rn. 4). Vorliegend ist es nicht beachtlich wahrscheinlich, dass der Kläger – seine Angaben als wahr unterstellt – erneut ins Visier der Taliban gelangen sollte. Der Kläger hat sich zwar der angeblich drohenden Zwangsrekrutierung durch Flucht entzogen. Er hat sich dadurch aber nicht so weit exponiert, dass damit zu rechnen wäre, dass die Taliban versuchen würden, ihn noch Jahre später in Kabul aufspüren. Der Kläger hat selbst nie aktiv gegen die Taliban gearbeitet oder deren Gegner unterstützt und ist daher nicht als hochrangiges Angriffsziel für die Taliban anzusehen. Hinzu kommt, dass die Taliban den seinerzeit noch minderjährigen Kläger nie zu Gesicht bekommen haben und sich schon deshalb schwertun dürften, den nunmehr volljährigen Kläger in Kabul ausfindig zu machen.
Die Stadt Kabul ist auch im Hinblick auf die allgemeine Sicherheitslage als Fluchtalternative geeignet. Das Risiko, dort durch Anschläge Schaden an Leib oder Leben zu erleiden, ist weit unterhalb der Schwelle der beachtlichen Wahrscheinlichkeit. Das Gericht folgt insoweit den tatsächlichen und rechtlichen Ausführungen des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (vgl. z.B. B.v. 4.8.2017 – 13a ZB 17.30791 – juris Rn. 6; B.v. 11.4.2017 – 13a ZB 17.30294 – juris Rn. 5; vgl. dazu auch unten unter 2.2.3). Die Stadt Kabul ist für die Kläger auf dem Luftweg auch sicher zu erreichen.
Dem Kläger ist es auch wirtschaftlich zumutbar, sich in Kabul niederzulassen. Zumutbar ist eine Rückkehr zwar nur dann, wenn der Ort der inländischen Schutzalternative ein wirtschaftliches Existenzminimum ermöglicht, zum Beispiel durch zumutbare Beschäftigung oder auf sonstige Weise. Diese Voraussetzung ist nicht gegeben, wenn den Asylsuchenden am Ort der internen Schutzalternative ein Leben erwartet, das zu Hunger, Verelendung und zum Tod führt oder wenn er dort nicht anderes zu erwarten hat als ein „Dahinvegetieren am Rande des Existenzminimums“ (BVerwG, B.v. 17.5.2006 – 1 B 100/05 – juris). Im Hinblick auf den internen Schutz gemäß § 3e Abs. 1 Nr. 2 AsylG muss für den Rückkehrer in dem schutzgewährenden Landesteil auch die Existenzgrundlage damit soweit gesichert sein, dass von ihn erwartet werden kann, dass er sich vernünftigerweise dort aufhält. Dies geht als Zumutbarkeitsmaßstab über das Fehlen einer im Rahmen des § 60 Abs. 7 Satz 1 und Satz 5 AufenthG beachtlichen existenziellen Notlage hinaus, wobei das Bundesverwaltungsgericht bislang offengelassen hat, welche darüberhinausgehenden wirtschaftlichen und sozialen Standards erfüllt sein müssen (vgl. BVerwG, U.v. 29.5.2008 – 10 C 11.07 – juris Rn. 35).
Vorliegend ist ungeachtet des Umstandes, dass der Kläger nach seinen Angaben in Afghanistan keine Schulbildung genossen hat, davon auszugehen, dass er bei einer Rückkehr in sein Heimatland in der Lage wäre, in Kabul einen Lebensunterhalt oberhalb des Existenzminimums insoweit zu verdienen, dass es ihm zumutbar ist, sich dort niederzulassen. Das Gericht verkennt dabei nicht die aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Verhältnisse in Afghanistan, insbesondere Kabul, nach wie vor schwierige Lage für Rückkehrer, dort Arbeit zu finden. Der Kläger hat die Frage des Bundesamts, wie er im Fall seiner Rückkehr seinen Lebensunterhalt verdienen könne, dahingehend beantwortet, er würde nach Hilfsarbeiten fragen. Er ging also offensichtlich selbst davon aus, dass ihm die Sicherung seines Lebensunterhalts durchaus möglich sei. Zwar hat der Kläger in Afghanistan nach seinen Angaben nie eine Schule besucht und nur Vieh gehütet. Er nimmt jedoch ausweislich der in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Unterlagen inzwischen an einem Lehrgang der Volkshochschule teil, der sich am Lehrplan der 7. bzw. 8. Jahrgangsstufe der Mittelschule orientiert, und hat eigenen Angaben zufolge mehrere Praktika absolviert. Zudem verfügt er über die in der mündlichen Verhandlung unter Beweis gestellte Fähigkeit, sich auf Deutsch und damit in einer Fremdsprache jedenfalls im Grundsatz verständlich zu machen. Es ist davon auszugehen, dass ihm diese Fähigkeiten im Falle einer Rückkehr in sein Heimatland zu einer im Vergleich zu seinen Landsleuten guten Ausgangslage für die Suche nach Arbeit, und sei es nur in Form von Hilfsarbeiten, verhelfen werden.
2.1.2 Soweit der Kläger sich darauf beruft, dass ihm in Afghanistan wegen seiner homosexuellen Neigung Verfolgung im Sinne des § 3 Abs. 1 AsylG drohe, kann er damit ebenfalls nicht durchdringen. Dem Kläger ist es nicht gelungen, dem Gericht seine angebliche homosexuelle Neigung schlüssig und nachvollziehbar darzulegen. Zwar dürfen die Anforderungen an eine nachvollziehbare Schilderung der eigenen sexuellen Neigung nicht überspannt werden. Insbesondere das Alter und die Herkunft des Klägers, der in ländlichem Umfeld in einem islamisch geprägten Land aufgewachsen ist, sind zu berücksichtigen. Seine Angaben zu seiner angeblichen Homosexualität sind jedoch derart detailarm, dass sie auch unter Berücksichtigung dieser Umstände nicht geeignet sind, ein auch nur ansatzweise nachvollziehbares Bild seiner sexuellen Orientierung zu vermitteln.
Soweit der Kläger vorbringt, er habe seine angebliche Homosexualität deshalb nicht schon bei seiner Anhörung vor dem Bundesamt erwähnt, weil er vor seinen Landsleuten – wie dem Dolmetscher – hierüber nicht sprechen könne, hat er dies zwar in der mündlichen Verhandlung dadurch untermauert, dass er auch dort nicht bereit war, in Anwesenheit des vom Gericht hinzugezogenen Dolmetschers über seine sexuelle Neigung zu berichten, sondern erst nachdem dieser auf ausdrücklichen Wunsch des Klägers hin den Gerichtssaal verlassen hatte. Allerdings kann der Verzicht auf den Dolmetscher nicht dazu führen, die Anforderungen an die Glaubhaftigkeit seines Vorbringens herabzusetzen. Es obliegt vielmehr dem Asylsuchenden, sein individuelles Schicksal schlüssig und im Falle nicht hinreichender Deutschkenntnissen unter Inanspruchnahme des vom Gericht dann grundsätzlich hinzuziehenden Dolmetschers (vgl. § 55 VwGO i.V.m. § 185 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 GVG) darzulegen. Verzichtet er hierauf, hat er sich der Möglichkeit, sich auf die Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör zu berufen, begeben. Den mangelnden Deutschkenntnissen geschuldete Schwierigkeiten bei der Glaubhaftmachung seines individuellen Schicksals gehen dann zu seinen Lasten. Andernfalls hätte es der Asylbewerber in der Hand, den Ausgang des Asylverfahrens allein dadurch zu seinen Gunsten zu beeinflussen, dass er auf den Dolmetscher verzichtet. Auf das mit dem Verzicht einhergehende Risiko, sich aufgrund von mangelnden Sprachkenntnissen nicht hinreichend verständlich machen und daher sein Verfolgungsschicksal nicht ausreichend glaubhaft machen zu können, wurde der Kläger seitens des Gerichts auch ausdrücklich hingewiesen. Im Übrigen scheitert die Glaubhaftmachung im vorliegenden Fall nach dem Eindruck, den das Gericht in der mündlichen Verhandlung vom Kläger und seinen Sprachkenntnissen gewonnen hat, weniger an dessen mangelnden Deutschkenntnissen, als vielmehr am fehlenden eigenen Erleben und dem daraus folgenden Unvermögen, seine angebliche homosexuelle Neigung schlüssig darzulegen. Zu dieser Einschätzung gelangt das Gericht aus folgenden Gründen:
Der Kläger schildert, er habe zum ersten Mal gemerkt, dass es sich zu Männern hingezogen fühle, als er 15 oder 16 Jahre alt gewesen sei. Als er dies festgestellt habe, sie dies für ihn normal gewesen. Er habe sofort akzeptiert, dass er homosexuell gewesen sei. Berücksichtigt man, dass der Kläger nach seinen Angaben auf dem Land und ohne jegliche Schulbildung in einem vom Islam geprägten Land aufgewachsen ist, in dem Homosexualität sowohl gesellschaftlich geächtet wird als auch nach den religiösen und staatlichen Gesetzen unter Strafe steht, erscheint diese Aussage nur schwer nachvollziehbar. Vielmehr wäre zu erwarten gewesen, dass der Kläger von sich aus zumindest auch von Zweifeln, Gewissenskonflikten oder der Furcht vor negativen Konsequenzen berichtet. Erst auf entsprechende Nachfrage des Gerichts, welche Gefühle und Empfindungen er gehabt habe, ergänzte der Kläger, er wisse, dass Beziehungen zwischen Männern in Afghanistan nicht möglich seien. Er habe auch Angst gehabt. Gleichwohl blieb er bei seiner Kernaussage, er habe sich nur gefreut.
Rudimentär bleibt aber nicht nur die Schilderung der eigenen Gedanken und Gefühle bei Entdeckung der eigenen Homosexualität – was für sich genommen angesichts der Herkunft und des Bildungshintergrunds des Klägers noch nachvollziehbar sein könnte – sondern auch der Umstände seines ersten sexuellen Kontakts. Hierzu vermag der Kläger lediglich anzugeben, dass er mit einem Nachbarjungen geschlafen habe. Sie seien in den Bergen versteckt gewesen. Ein Nachbar habe dies gesehen. Wo dies genau passiert sei, könne er nicht sagen, er wisse nur, dass sie versteckt gewesen seien. Auch auf die nochmalige Nachfrage des Gerichts erklärt der Kläger lediglich, er habe sich versteckt. Die Nachbarn gingen vorbei und sähen dies. Erst auf die Frage seines Bevollmächtigten, ob es im Wald gewesen sei, bejahte dies der Kläger, und erklärt auf die weitere Frage des Gerichts, dass es außerhalb eines Hauses gewesen sei. Warum der Nachbar ihn mit dem Nachbarsjungen erwischt habe, könne er sich nicht erklären, vielleicht sei er ihnen in die Berge gefolgt. Die Schilderung dieses Erlebnisses ist auch unter Berücksichtigung der sprachlichen Barriere derart detailarm, dass das Gericht von dessen Wahrheit nicht überzeugt ist. Wer in einem Land, in dem Homosexualität von der Gesellschaft missbilligt wird und unter Strafe steht, erstmals sexuellen Kontakt mit einem gleichgeschlechtlichen Partner aufnimmt und damit das Risiko schwerwiegender Folgen bis hin zur Tötung durch die eigene Familie eingeht, dürfte sehr genau wissen, wo dieses Treffen stattgefunden hat. Dass der Kläger den Ort, an dem er sich mit dem Nachbarsjungen getroffen haben will, nicht bzw. auch auf mehrmalige Nachfrage hin nur äußerst vage benennen kann, verwundert um so mehr, als der Kläger angibt, sich dort versteckt zu haben. Wer auf diese Weise Vorkehrungen zum Schutz vor Entdeckung trifft, hat sich mit der Auswahl des Ortes gerade bewusst beschäftigt. Dass er diesen dann nicht angeben kann, ist nicht nachvollziehbar.
Auch die Umstände, unter denen der Kläger und sein Partner bereits beim ersten sexuellen Kontakt angeblich gesehen worden sind, vermag der Kläger nicht schlüssig und widerspruchsfrei darzulegen. Eine plausible Erklärung für die Entdeckung durch den Nachbarn hat der Kläger nicht abgegeben. Der erst auf nochmalige Nachfrage abgegebener Erklärungsversuch, dass ihm der Nachbar in die Berge gefolgt sein könnte, steht im Widerspruch zur ursprünglichen Aussage, dass die Nachbarn vorbeigingen und dies eben sähen. Schließlich widersprechen sich auch die Schilderungen, wem der Nachbar von seiner Entdeckung berichtet haben soll. Während der Kläger in seinem Schreiben vom 2. Februar 2017 angibt, seine Eltern hätten von anderen Leuten erfahren, dass er homosexuell sei, und seien von den Nachbarn beleidigt worden, gibt er in der mündlichen Verhandlung an, sein Vater würde ihn umbringen, wenn er davon wüsste. Nur seine Mutter wisse Bescheid. Die hierfür abgegeben Erklärung, dass er in seinem Schreiben versehentlich „Eltern“ statt „Mutter“ geschrieben habe, überzeugt nicht, zumal das Schreiben vom 2. Februar 2017 nach den eigenen Angaben des Klägers seinen Schilderungen entsprechend von einer Betreuerin aufgesetzt und von ihm dann geschrieben worden sein soll. Im weiteren Verlauf der mündlichen Verhandlung spricht der Kläger dann wieder davon, dass seine Eltern bis heute nichts von seiner Homosexualität wüssten. Diese Aussagen sind nicht miteinander in Einklang zu bringen.
Angesichts all dieser Ungereimtheiten vermögen auch die Aussagen des Klägers zu der in Deutschland angeblich weiter ausgelebten homosexuellen Neigung das Gericht hiervon nicht zu überzeugen. Auch insoweit bleibt die Schilderung des Klägers im Wesentlichen auf die Aussage beschränkt, dass es zu einem sexuellen Kontakten mit einem Mann gekommen sei, den er am selben Tag auf der Straße kennengelernt habe. Allein der Umstand, dass der Kläger hier einen Ort benennen kann, an dem er diesen kennengelernt haben will, vermag das Gericht nach dem Gesamteindruck, den der Kläger in der mündlichen Verhandlung hinterlassen hat, nicht von seiner angeblichen homosexuellen Neigung zu überzeugen.
2.2 Der Kläger hat auch keinen Anspruch auf Gewährung subsidiären Schutzes im Sinne des § 4 Abs. 1 AsylG.
2.2.1 Es ist weder etwas dafür vorgetragen noch sonst ersichtlich, dass dem Klägern im Fall der Rückkehr nach Afghanistan die Todesstrafe droht (§ 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AsylG).
2.2.2 Aus den oben dargestellten Gründen (2.1) droht dem Kläger in Afghanistan auch keine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung im Sinn des § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AsylG.
2.2.3 Auch eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit des Klägers infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines innerstaatlichen bewaffneten Konflikts kann nicht angenommen werden (§ 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AsylG). Das Risiko für den Kläger, in seiner Herkunftsprovinz Paktya, oder in Kabul, wohin eine Abschiebung zunächst erfolgen würde, durch Anschläge Schaden an Leib oder Leben zu erleiden, ist nach den hierfür von der Rechtsprechung entwickelten Maßstäben weit unter der beachtlichen Wahrscheinlichkeit.
In der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs ist rechtsgrundsätzlich geklärt, dass und unter welchen Voraussetzungen eine erhebliche individuelle Gefahr für Leib oder Leben im Rahmen eines innerstaatlichen bewaffneten Konflikts (§ 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AsylG) besteht und dass es für die Feststellung der erforderlichen Gefahrendichte u.a. einer quantitativen Ermittlung des Tötungs- und Verletzungsrisikos bedarf (BayVGH, B.v. 17.1.2017 – 13a ZB 16.30182 – juris Rn. 4; BVerwG, U.v. 17.11.2011 – 10 C 13.10 – juris). Für die Frage, ob die Kläger bei Rückkehr in ihr Heimatland einer erheblichen individuellen Gefahr für Leib oder Leben infolge willkürlicher Gewalt ausgesetzt sind, ist zu prüfen, ob von einem bewaffneten Konflikt in der Zielregion für eine Vielzahl von Zielpersonen eine allgemeine Gefahr ausgeht, die sich in der Person der Kläger so verdichtet, dass sie für diese eine erhebliche individuelle Gefahr darstellt. Denn auch eine von einem bewaffneten Konflikt ausgehende allgemeine Gefahr kann sich individuell verdichten und damit die Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AsylG erfüllen. Eine Individualisierung der allgemeinen Gefahr kann auch dann, wenn individuelle gefahrerhöhende Umstände in der Person der Kläger fehlen, ausnahmsweise bei einer außergewöhnlichen Situation eintreten, die durch einen so hohen Gefahrengrad gekennzeichnet ist, dass praktisch jede Zivilperson allein aufgrund ihrer Anwesenheit in dem betroffenen Gebiet einer ernsthaften individuellen Bedrohung ausgesetzt wäre. Liegen keine gefahrerhöhenden persönlichen Umstände vor, ist ein besonders hohes Niveau willkürlicher Gewalt erforderlich (BayVGH, U.v. 17.1.2017 a.a.O. – juris Rn. 5.; BVerwG, U.v. 17.11.2011 a.a.O. – juris Rn. 19).
Zur Ermittlung einer für die Annahme einer erheblichen individuellen Gefahr ausreichenden Gefahrendichte ist aufgrund aktueller Quellen die Gesamtzahl der in der Herkunftsprovinz lebenden Zivilpersonen annäherungsweise zu ermitteln und dazu die Häufigkeit von Akten willkürlicher Gewalt sowie die Zahl der dabei Verletzten und Getöteten in Beziehung zu setzen. Insoweit hat das Bundesverwaltungsgericht das vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof ermittelte Risiko für das Jahr 2009 von ca. 1:800 oder 0,12% in der Herkunftsprovinz verletzt oder getötet zu werden, sowie die auf der Grundlage dieser Feststellungen gezogene Schlussfolgerung, dass der Kläger bei seiner Rückkehr in sein Herkunftsland keiner erheblichen individuellen Gefahr für Leib oder Leben infolge willkürlicher Gewalt ausgesetzt sei, im Ergebnis revisionsrechtlich nicht beanstandet (BVerwG, U.v. 17.11.2011 a.a.O. – juris Rn. 22).
Gemessen daran ist nach den dem Gericht vorliegenden und in das Verfahren eingeführten Erkenntnismitteln die Gewährung subsidiären Schutzes nach § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AsylG für die Kläger nicht gerechtfertigt.
In der südöstlichen Region Afghanistans, zu der laut UNAMA (Afghanistan, Protection of Civilians in Armed Conflict, Annual Report 2016, S. 4f.) neben Paktya, der Herkunftsprovinz des Klägers, auch die Provinzen Ghazni, Khost und Paktika gehören, leben insgesamt etwa 2,7 Millionen Menschen (https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Provinzen_Afghanistans) und wurden im ersten Halbjahr 2017 517 Opfer gezählt (UNAMA, Afghanistan, Protection of Civilans in Armed Conflict, Midyear Report 2017, S. 73). Hochgerechnet auf das Jahr 2017 ergeben sich also 1.034 Opfer. Für die südöstliche Region errechnet sich somit ein Risiko von 1:2611, dort verletzt oder getötet zu werden. Geht man zugunsten der Kläger hinsichtlich der Opferzahlen von einer um einen Sicherheitszuschlag von 50% erhöhten Opferzahl, dann also 2.068 Opfern aus, beträgt die Wahrscheinlichkeit 1:1306 und liegt damit – auch unter Berücksichtigung der gegenüber 2016 gestiegenen Opferzahlen – immer noch weit unter dem von der Rechtsprechung entwickelten Maßstab von 1:800.
In der Zentralregion, die laut UNAMA die Provinzen Kabul, Kapisa, Logar, Maidan Wardak, Parwan und Panjshir umfasst, wurden im ersten Halbjahr 2017 insgesamt 1.254 Menschen verletzt oder getötet (UNAMA, Afghanistan, a.a.O., Midyear Report 2017, S. 73). Für das gesamte Jahr 2017 errechnet sich somit eine (hochgerechnete) Opferzahl von 2.508, die sich unter Berücksichtigung eines Sicherheitszuschlags von 50% auf 3.762 erhöht. Ausgehend von einer Einwohnerzahl von etwa 6,6 Millionen ergibt sich somit für die Zentralregion ein Risiko von 1:1754, dort verletzt oder getötet zu werden.
Für die Provinz Kabul selbst errechnet sich ausgehend von einer Einwohnerzahl von etwa 4,3 Millionen und einer auf das ganze Jahr hochgerechneten und um 50% erhöhten Opferzahl von 3.144 ein Risiko von 1:1367, dort Opfer eines sicherheitsrelevanten Vorfalls zu werden. Auch unter Berücksichtigung der im Vergleich zum Vorjahr nochmals gestiegenen Opferzahlen in der Provinz Kabul und der nahezu unverändert hohen Opferzahlen in ganz Afghanistan (vgl. UNAMA a.a.O., Midyear Report 2017, S. 3 und 5) liegt somit das Risiko, verletzt oder getötet zu werden, auch in der Provinz Kabul selbst weit unter dem hierfür anzusetzenden Maßstab von 1:800.
2.2. Auch Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 oder Abs. 7 AufenthG liegen nicht vor.
Bei den national begründeten Abschiebungsverboten nach § 60 Abs. 5 AufenthG i.V.m. § 3 Europäische Menschenrechtskonvention – EMRK – und den nach § 60 Abs. 7 AufenthG handelt es sich um einen einheitlichen und nicht weiter teilbaren Verfahrensgegenstand (BVerwG, U.v. 8.9.2011 – 10 C 14.10 – juris Rn. 17).
Nach § 60 Abs. 5 AufenthG darf ein Ausländer nicht abgeschoben werden, soweit sich aus der EMRK ergibt, dass die Abschiebung unzulässig ist. Dem Kläger droht im Fall einer Rückkehr in sein Heimatland keine gegen Art. 3 EMRK oder ein anderes Grundrecht nach der EMRK verstoßende Behandlung.
Zwar kann auch die allgemeine bzw. humanitäre Lage im Heimatland eine unmenschliche Behandlung im Sinne des Art. 3 EMRK begründen. Ein Abschiebungsverbot infolge der allgemeinen Situation der Gewalt im Herkunftsland kommt aber nur in Fällen ganz extremer Gewalt in Betracht und auch schlechte humanitäre Bedingungen können nur in besonderen Ausnahmefällen ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 AufenthG i.V.m. Art. 3 EMRK begründen. In Afghanistan ist die allgemeine bzw. humanitäre Lage nicht so ernst, dass eine Abschiebung ohne weiteres eine Verletzung von Art. 3 EMRK bedeuten würde (BayVGH, B.v. 10.4.2017 – 13a ZB 17.30266 – juris – zur Südostregion; B.v. 4.8.2017 – 13a ZB 17.30791 – juris zur Zentralregion). Das Gericht geht vielmehr auch in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (B.v. 23.1.2017 – 13a ZB 17.30044 – juris Rn. 5) davon aus, dass der Kläger als arbeitsfähiger, gesunder Mann selbst ohne nennenswertes Vermögen und ohne familiären Rückhalt im Fall einer zwangsweisen Rückführung nach Afghanistan in der Lage wäre, durch Gelegenheitsarbeiten wenigstens ein kleines Einkommen zu erzielen und sich damit ein Leben am Rand bzw. – aus den oben dargestellten Gründen, insbesondere der in Deutschland genossenen Schulbildung – sogar oberhalb des Existenzminimums zu finanzieren.
Anhaltspunkte für ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 7 AufenthG sind weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.
Die allgemeine Gefahrenlage in Afghanistan stellt sich auch nicht als für den Kläger als derart zu einer extremen Gefahrenlage zugespitzt dar, dass eine entsprechende Anwendung des § 60 Abs. 7 AufenthG geboten wäre. Wann allgemeine Gefahren von Verfassungs wegen zu einem Abschiebungsverbot führen, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Die drohenden Gefahren müssten nach Art, Ausmaß und Intensität von einem solchen Gewicht sein, dass sich daraus bei objektiver Betrachtung für den Ausländer die begründete Furcht ableiten lässt, in erheblicher Weise ein Opfer der extremen allgemeinen Gefahrenlage zu werden. Dies setzt voraus, dass der Ausländer mit hoher Wahrscheinlichkeit alsbald nach seiner Ausreise in sein Heimatland in eine lebensgefährliche Situation gerät, aus der er sich weder allein noch mit erreichbarer Hilfe anderer befreien kann, der Ausländer somit gleichsam sehenden Auges dem sicheren Tod oder schwersten Verletzungen ausgeliefert würde (vgl. z.B. BVerwG, U.v. 29.6.2010 – 10 C 10.09 – juris Rn. 15.). Eine solche Gefahrenlage liegt, wie oben zu § 60 Abs. 5 AufenthG bereits ausgeführt, nicht vor.
3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. Das Verfahren ist gerichtskostenfrei, § 83b AsylG.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit hat ihre Rechtsgrundlage in § 167 VwGO i.V.m. § 708 ff. ZPO.