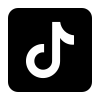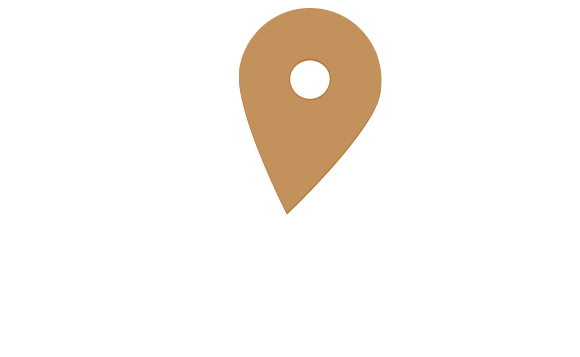Aktenzeichen 22 ZB 20.245
VwGO § 124 Abs. 2 Nr. 5, § 173
ZPO § 278 Abs. 1
Leitsatz
1. Pauschale ergänzende Bezugnahmen auf frühere Verfahren und frühere Schriftsätze sind unbeachtlich, wenn nicht klar zu Tage tritt, welche Ausführungen gemeint sind, an welcher Stelle sie sich finden und inwiefern sie entscheidungserheblich sein, d.h. Einfluss darauf haben sollen, ob das angegriffene Urteil im Ergebnis richtig oder falsch ist. (Rn. 9) (redaktioneller Leitsatz)
2. Die nach § 17 Abs. 4a Satz 1 BImSchG gesetzlich vorgegebene zweistufige Prüfung, die nur im Fall der Bejahung eines (auf der ersten Stufe zu prüfenden) atypischen Falls auf der zweiten Stufe der Behörde Ermessen einräumt, kann durch Vollzugshinweise nicht abbedungen werden. (Rn. 15) (redaktioneller Leitsatz)
3. Das Gericht „soll“ in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche Beilegung des Rechtsstreits oder einzelner Streitpunkte bedacht sein. Die Beurteilung dagegen, ob eine gütliche Beilegung möglich erscheint und wie diese gegebenenfalls zu erreichen ist, ist Teil der im Ermessen des Gerichts liegenden Verfahrensleitung. (Rn. 24) (redaktioneller Leitsatz)
Verfahrensgang
M 28 K 18.304 2019-11-20 Urt VGMUENCHEN VG München
Tenor
I. Der Antrag wird abgelehnt.
II. Die Klägerin trägt die Kosten des Zulassungsverfahrens.
III. Der Streitwert wird auf 125.475 € festgesetzt.
Gründe
I.
1. Die Klägerin wehrt sich gegen den Bescheid vom 14. Dezember 2017, mit dem das Landratsamt Landsberg am Lech eine von der Klägerin zu erbringende Sicherheitsleistung in Höhe von 501.900 € angeordnet hat, um die Erfüllung der Nachsorgepflicht nach § 5 Abs. 3 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BlmSchG) durch die Klägerin sicherzustellen.
Die Klägerin betreibt auf einem nicht in ihrem Eigentum stehenden Grundstück aufgrund einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung vom 16. September 1996 eine Abfallentsorgungsanlage im Sinn des § 4 Abs. 1 Satz 1 BImSchG; in ihr werden mineralische Baustoffe aufbereitet. Der Klägerin wurde im genannten Bescheid vom 14. Dezember 2017 erlaubt, die Sicherheitsleistung zu erbringen in Form entweder (a) einer unbedingten und unbefristeten selbstschuldnerischen Bankbürgschaft, (b) einer selbstschuldnerischen Konzernbürgschaft mit einem jährlich zu erneuernden Testat eines Wirtschaftsprüfers, das die ausreichende Deckung der Bürgschaft bestätige, (c) einer dinglichen Sicherheit oder (d) einer sogenannten Patronatserklärung, wobei im Fall (d) das sicherungspflichtige Unternehmen nachzuweisen habe, dass der Sicherungszweck erfüllt und die finanzielle Leistungsfähigkeit gegeben sei.
2. Gegen diesen Bescheid, der für sofort vollziehbar erklärt worden war, erhob die Klägerin Anfechtungsklage zum Bayerischen Verwaltungsgericht München und begehrte zugleich, die aufschiebende Wirkung dieser Klage wiederherzustellen. Das Verwaltungsgericht lehnte den vorläufigen Rechtsschutzantrag mit Beschluss vom 21. August 2018 im Wesentlichen ab; Erfolg hatte der Antrag nur insoweit, als in Nr. 2 des Bescheids festgelegt ist, dass ein Patron bei einem Rating eine Rangstufe erreichen müsse, die einer Rangstufe I der „Initiative Finanzstandort Deutschland (IFD)“ bei einer Ausfallrate bis zu 0.3 entspreche. Die gegen die Versagung vorläufigen Rechtsschutzes im Übrigen eingelegte Beschwerde wies der Verwaltungsgerichtshof mit Beschluss vom 9. Januar 2019 – 22 CS 18.2003 – zurück. Eine Anhörungsrüge gegen diesen Beschluss war erfolglos (BayVGH, B.v. 2.4.2019 – 22 CS 19.280). Mit Urteil vom 20. November 2019 wies das Verwaltungsgericht die Klage überwiegend ab; als rechtswidrig aufgehoben wurden nur Nr. 2 Spiegelstrich 4 Sätze 2 bis 4 des angefochtenen Bescheids vom 14. Dezember 2017 (dies ist die oben genannte Anordnung, dass ein Patron eine bestimmte Rangstufe erreichen müsse). Das Urteil wurde der Klägerin am 7. Januar 2020 zugestellt.
3. Die Klägerin hat am 28. Januar 2020 die Zulassung der Berufung beantragt und den Antrag mit Schriftsätzen vom 28. Februar 2020 (eingegangen am 2.3.2020) und 6. Mai 2020 begründet.
Der Antragsgegner hat beantragt,
die Berufung nicht zuzulassen.
Wegen der Einzelheiten wird auf die Gerichtsakten beider Rechtszüge einschließlich der beigezogenen Akten zu den beim Verwaltungsgerichtshof durchgeführten Verfahren 22 CS 18.2003 und 22 CS 19.280 Bezug genommen.
II.
Der Antrag ist zulässig, aber unbegründet.
1. Die Klägerin macht geltend, es bestünden ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils im Sinn des § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO. Ernstliche Zweifel im Sinn des § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO bestehen dann, wenn nach dem Vortrag des Rechtsmittelführers gegen die Richtigkeit des Urteils gewichtige Gesichtspunkte sprechen. Davon ist immer dann auszugehen, wenn der Rechtsmittelführer einen einzelnen tragenden Rechtssatz oder eine erhebliche Tatsachenfeststellung mit schlüssigen Gegenargumenten in Frage gestellt hat und wenn sich nicht ohne nähere Prüfung die Frage beantworten lässt, ob die Entscheidung möglicherweise im Ergebnis aus einem andern Grund richtig ist (Kopp/Schenke, VwGO, 21. Aufl. 2015, § 124 Rn. 7 bis 7d m.w.N.). Diese schlüssigen Gegenargumente müssen gemäß § 124a Abs. 4 Satz 4 VwGO innerhalb offener Frist vorgebracht werden. Der Rechtsmittelführer muss darlegen, warum die angegriffene Entscheidung aus seiner Sicht im Ergebnis falsch ist. Dazu muss er sich mit den entscheidungstragenden Annahmen des Verwaltungsgerichts konkret auseinandersetzen und im Einzelnen dartun, in welcher Hinsicht und aus welchen Gründen diese Annahmen ernstlichen Zweifeln begegnen (BVerfG, B.v. 8.12.2009 – 2 BvR 758/07 – NVwZ 2010, 634; Happ in: Eyermann, VwGO, 15. Aufl. 2019, § 124a Rn. 62 f. m.w.N.). Gemessen an diesen Voraussetzungen ergeben sich aus dem Vortrag der Klägerin keine ernstlichen Zweifel daran, dass das angegriffene Urteil im Ergebnis richtig ist.
1.1. Die Klägerin hat an mehreren Stellen ihrer rechtlichen Würdigung, mit der sie ihren Zulassungsantrag begründet, pauschal auf frühere Verfahren und frühere Schriftsätze verwiesen (so im Schriftsatz vom 28.2.2020, S. 3, 4. Absatz, letzter Satz: „Im Übrigen wird auf die Beschwerde gegen den Beschluss im Verfahren M 19 S 18.307 vom 6. September 2018 sowie die weiteren, dem Berufungsgericht vorliegenden Schriftsätze verwiesen“; S. 5, 1. Absatz: „Im Übrigen sei auf die gegen den Beschluss erhobene Anhörungsrüge vom 6. Februar 2019 verwiesen“, ferner im Schriftsatz vom 6.5.2020 auf S. 1). Derartige pauschale ergänzende Bezugnahmen sind unbeachtlich, wenn nicht klar zu Tage tritt, welche Ausführungen gemeint sind, an welcher Stelle sie sich finden und inwiefern sie entscheidungserheblich sein, d.h. Einfluss darauf haben sollen, ob das angegriffene Urteil im Ergebnis richtig oder falsch ist. Insbesondere könnte selbst die textliche Wiederholung erstinstanzlichen Vorbringens die substanzielle Darlegung der geltend gemachten Zulassungsgründe schon deshalb nicht ersetzen, weil ein zeitlich vor dem angegriffenen Urteil erfolgter Vortrag – naturgemäß – die gebotene substantiierte Auseinandersetzung mit den zeitlich nachfolgenden Entscheidungsgründen des Verwaltungsgerichts nicht zu leisten vermag (ständige Rechtsprechung. des Senats, vgl. nur BayVGH, B.v. 24.7.2019 – 22 ZB 19.132 – juris Rn. 15, B.v. 7.8.2018 – 22 ZB 18.1422 – juris Rn. 10 m.w.N.). Im vorliegenden Fall hat zwar auch das Verwaltungsgericht („zur Vermeidung von Wiederholungen“) weitgehend auf die gerichtlichen Begründungen im vorläufigen Rechtsschutzverfahren, nämlich auf seine eigenen Ausführungen (B.v. 21.8.2018 – M 19 S 18.307) sowie auf diejenigen des Verwaltungsgerichtshofs im Beschwerdeverfahren (B.v. 9.1.2019 – 22 CS 18.2003), Bezug genommen; den Gründen des Verwaltungsgerichtshofs hat sich das Verwaltungsgericht in vollem Umfang angeschlossen (Urteilsabdruck – UA – Rn. 20). Diese weitgehenden Bezugnahmen des Verwaltungsgerichts entbinden die Klägerin indes nicht davon, sich mit den Entscheidungsgründen substantiiert auseinander zu setzen, denn die in Bezug genommenen Gründe, die sich das Verwaltungsgericht auch für das Urteil zu eigen macht bzw. denen es sich anschließt, sind Teil der Urteilsbegründung. Die Klägerin wird daher dem Darlegungsgebot im Sinn des § 124a Abs. 4 Satz 4 VwGO nicht gerecht, soweit sie pauschal auf ihre Schriftsätze im vorläufigen Rechtsschutzverfahren verweist. Diese Schriftsätze können keine Auseinandersetzung mit den (zeitlich nachfolgenden) Gründen aus dem Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs im Beschwerdeverfahren (B.v. 9.1.2019 – 22 CS 18.2003) enthalten.
1.2. Die Klägerin sieht ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils deshalb, weil weder das Verwaltungsgericht in diesem Urteil noch das Verwaltungsgericht sowie der Verwaltungsgerichtshof im vorläufigen Rechtsschutzverfahren geprüft hätten, ob der Beklagte bei Erlass des angefochtenen Bescheides sein Ermessen ordnungsgemäß unter Berücksichtigung der maßgeblichen Vollzugshinweise ausgeübt habe (Schriftsatz vom 28.2.2020, Nr. 1 auf S. 3 und 4).
Damit kann die Klägerin nicht durchdringen. Dem Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs vom 9. Januar 2019 ist zu entnehmen, dass bei der behördlichen Entscheidung über die Anordnung einer Sicherheitsleistung nach § 17 Abs. 4a Satz 1 BImSchG zwischen dem „Ob“ der Anordnung und dem „Wie“ der Sicherheitsleistung zu unterscheiden ist; der Verwaltungsgerichtshof hat ausgeführt, die Ausgestaltung von § 17 Abs. 4a Satz 1 BImSchG als Soll-Vorschrift verdeutliche, dass von dem Verlangen nach einer Sicherheitsleistung nur in atypischen Fällen abzusehen sei; nur dann stehe die Entscheidung im Ermessen der Behörde; Ermessen sei allerdings der Behörde eingeräumt und von ihr pflichtgemäß auszuüben, soweit es um die Art der Sicherheitsleistung und um deren Höhe gehe. Der Verwaltungsgerichtshof hat hierbei der von ihm in Bezug genommenen vorangegangenen Begründung des Verwaltungsgerichts (B.v. 21.8.2018 – M 19 S 18.307 – Nrn. 4 und 5 auf S. 13 bis 21) beigepflichtet (BayVGH, B.v. 9.1.2019 – 22 CS 18.2003 – juris Rn. 7). Auf diese vom Verwaltungsgerichtshof aufgezeigte, im Gesetz selbst getroffene Unterscheidung zwischen dem „Ob“ der Anordnung einer Sicherheitsleistung einerseits und der Höhe der Sicherheitsleistung andererseits geht die Begründung des Berufungszulassungsantrags nicht ein; aus ihr wird nicht erkennbar, in Bezug auf welchen sonstigen Teil der angefochtenen Entscheidung des Landratsamts Ermessen bestehen soll, weshalb ein Ermessensfehler vorliegend soll und welche genau beschriebenen Ausführungen beider Gerichte im vorläufigen Rechtsschutzverfahren zu ernstlichen Zweifeln an der Richtigkeit des angegriffenen Urteils berechtigen sollen. Eine diesbezügliche substantiierte Begründung wäre aber gemäß § 124a Abs. 4 Satz 4 VwGO erforderlich.
Mit ihrer Replik vom 6. Mai 2020 auf die Antragserwiderung (vom 22.4.2020) macht die Klägerin geltend, ein atypischer Fall sei gerade deswegen gegeben, weil sie mit ihrem Schwesterunternehmen, bei dem ausreichende Eigenentsorgungskapazitäten bestünden, einen „Garantievertrag“ abgeschlossen habe (Schriftsatz vom 6.5.2020 Nr. 1.1). Unabhängig davon, ob dieser Vortrag (mit dem ein anderer als der bisher in der Antragsbegründung verfolgte rechtliche Ansatz zum Regel- und Ausnahmeverhältnis in § 17 Abs. 4a Satz 1 BImSchG in den Mittelpunkt gestellt wird) den Anforderungen gemäß § 124a Abs. 4 Satz 4 VwGO entspricht, lässt sich den Ausführungen des Verwaltungsgerichts zum Inhalt dieses „Garantievertrags“ entnehmen, dass dieser nicht geeignet wäre, einen Ausnahmefall zu bejahen (vgl. hierzu näher unten Nr. 1.5).
Soweit die Klägerin darauf verweist, dass sie seit dem 1. März 2020 die ehemals von ihrem Schwesterunternehmen betriebene Grube selbst betreibe (und diese Übernahme schon unter dem 27.2.2020 dem Landratsamt angezeigt habe), ergibt sich aus den Darlegungen der Klägerin nicht, dass hierdurch eine Sicherheitsleistung nach § 17 Abs. 4a Satz 1 BImSchG entbehrlich würde. Es liegt auf der Hand, dass die Sicherheitsleistung neben der Ermangelung eigener Entsorgungskapazitäten auch andere Risiken für die öffentliche Hand erfassen soll, die gerade im Fall der Insolvenz eines Abfallentsorgungsbetriebs bestehen können.
Zur Höhe der Sicherheitsleistung äußert sich die Klägerin im vorliegenden Zulassungsverfahren erstmals im Schriftsatz vom 6. Mai 2020 (Nr. 1.2 auf S. 2) und damit außerhalb der Frist des § 124a Abs. 4 Satz 4 VwGO. Der Vortrag ist daher unbeachtlich. Abgesehen davon setzt sie nur ihre eigene Rechtsauffassung derjenigen des Verwaltungsgerichtshofs und des Verwaltungsgerichts in den früheren Verfahren entgegen, ohne neue Argumente anzuführen.
Im Zusammenhang mit der obigen Thematik macht die Klägerin ernstliche Zweifel dahingehend geltend, dass das Verwaltungsgericht in seinem Beschluss (vom 21.8.2018) nur darauf verwiesen habe, dass es selbst nicht an die Vollzugshinweise gebunden sei, hierbei aber rechtsfehlerhaft verkannt habe, dass der Beklagte an die Vollzugshinweise gebunden sei und eine Ermessensprüfung hätte vornehmen müssen (Schriftsatz vom 28.2.2020, S. 3, 4. Abschnitt). Auch dieser Einwand rechtfertigt nicht die Zulassung der Berufung. Unabhängig davon, dass die Klägerin auch hierbei die gebotene Unterscheidung zwischen dem „Ob“ und der Höhe der Sicherheitsleistung übergeht, hat sich der Verwaltungsgerichtshof in den Gründen seines Beschwerdebeschlusses (die sich das Verwaltungsgericht im angegriffenen Urteil zu eigen gemacht hat) mit den Vollzugshinweisen und denjenigen Argumenten befasst, die die Klägerin aus den Vollzugshinweisen für sich ableiten möchte. Er hat allerdings (wie schon in seinem Beschluss zur Anhörungsrüge ausgeführt wurde, vgl. B.v. 2.4.2019 – 22 CS 19.280 – juris Rn. 7) die sich aus der Anwendung der Vollzugshinweise ergebenden Rechtsfolgen anders als die Klägerin bewertet. Sollte die Klägerin mit ihrer jetzigen Antragsbegründung meinen, aus dem Beschluss des Verwaltungsgerichts im vorläufigen Rechtsschutzverfahren und/oder aus dem Beschwerdebeschluss des Verwaltungsgerichtshofs ergebe sich die (nach Ansicht der Klägerin zutreffende) Rechtsauffassung, dass der Beklagte auch bei der Frage, ob ein atypischer Fall vorliege, Ermessen ausüben dürfe und müsse, und Selbiges sähen auch die Vollzugshinweise vor, so wäre dem gleichfalls nicht zu folgen. Die gesetzlich vorgegebene zweistufige Prüfung, die nur im Fall der Bejahung eines (auf der ersten Stufe zu prüfenden) atypischen Falls (erst) auf der zweiten Stufe der Behörde Ermessen einräumt, kann durch Vollzugshinweise nicht abbedungen werden. Gegenteiliges hat der Verwaltungsgerichtshof in den Abschnitten des Beschwerdebeschlusses vom 9. Januar 2019, in denen er sich mit den Vollzugshinweisen befasst hat, auch nicht entschieden (vgl. BayVGH, B.v. 9.1.2019 – 22 CS 18.2003 – juris Rn. 11, 20, 21 und 25). Dies hat übrigens die Klägerin selbst bereits mit ihrer Anhörungsrüge eingeräumt, in der sie bemängelte (Schriftsatz vom 6.2.2019 im Verfahren 22 CS 19.280, S. 2 Nr. 1), der Verwaltungsgerichtshof habe zu Unrecht angenommen, der Behörde stehe ein Ermessen nur zu, soweit es um die Art und die Höhe der Sicherheitsleistung gehe (vgl. BayVGH, B.v. 2.4.2019 – 22 CS 19.280 – juris Rn. 6).
1.3. Die Klägerin meint in diesem Zusammenhang ferner, an der Ergebnisrichtigkeit des angegriffenen Urteils bestünden deswegen ernstliche Zweifel, weil der Verwaltungsgerichtshof, auf dessen Beschluss vom 9. Januar 2019 das Verwaltungsgericht verweise, die Klägerin falsch zitiert habe. So habe die Klägerin z.B. zu keiner Zeit behauptet, bei dem noch nicht aufbereiteten Input-Material würde es sich nicht um Abfall handeln; vielmehr habe sie stets dargelegt, dass das Material nach Aufbereitung, Güteüberwachung und Zertifizierung als Produkt eingestuft und zu einem positiven Marktwert vermarktet werden könne (Schriftsatz vom 28.2.2020, S. 3, 5. Abschnitt). Auch damit kann die Klägerin nicht durchdringen. Sie bleibt schon jede gedanklich nachvollziehbare Argumentationskette, erst recht aber eine rechtlich stichhaltige Subsumtion zu der Frage schuldig, inwiefern aus einer (angeblich) falschen Zitierung einer bestimmten Passage im Vortrag der Klägerin (der damaligen Antragstellerin) ernstliche Zweifel daran folgen sollten, dass das angegriffene Urteil (bzw. der in Bezug genommene Beschluss vom 9.1.2019) im Ergebnis richtig ist. Davon unabhängig hat der Verwaltungsgerichtshof die Klägerin gerade nicht falsch zitiert und ihr nicht eine – von ihr nicht aufgestellte – Behauptung unterstellt. Vielmehr hat der Verwaltungsgerichtshof im genannten Beschluss den Vortrag der Klägerin in genau demselben Sinn wiedergegeben, auf den die Klägerin auch nunmehr Wert legt; er hat nämlich ausgeführt: „Die Antragstellerin betont nachdrücklich, dass der ‚Input‘ ihrer Anlage zwar als Abfall einzustufen sei und zunächst einen negativen Marktwert habe, dass aber ‚Recyclingbaustoffe, die behandelt (aufbereitet) wurden und den Richtwerten RW1 zuzuordnen sowie güteüberwacht und zertifiziert sind, … als Produkt [gelten] und … einen positiven Marktwert auf[weisen]‘ (Schriftsatz vom 6.9.2018 Nr. II 4)“ (vgl. BayVGH, B.v. 9.1.2019 – 22 CS 18.2003 – juris Rn. 9).
1.4. Schließlich macht die Klägerin ernstliche Zweifel im Sinn des § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO geltend mit der Begründung, der Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs vom 9. Januar 2019 (bzw. das hierauf verweisende Urteil) beruhe auf der – für sie unhaltbaren – Kernaussage, wonach „gerade dann, wenn ein Unternehmen – meist nach einer längeren wirtschaftlich und finanziell ungünstigen Entwicklung – insolvent geworden ist, (…) kein Verlass darauf (ist), dass der Geschäftsbetrieb in der Phase vor der Insolvenz genauso abgelaufen ist, wie er,in der Regel‘ verlaufen ist“. Mit dieser Aussage unterstelle nach Ansicht der Klägerin das Beschwerdegericht, dass Entsorgungsfirmen, die sich in einer finanziell schwierigen Situation befänden, im Zweifel ohnehin illegal handeln würden; ein solcher pauschaler „Generalverdacht“ aber dürfe nicht Grundlage einer gerichtlichen Entscheidung sein (Schriftsatz vom 28.2.2020, S. 3 unten, S. 4 oben: Schriftsatz vom 6.5.2020 Nr. 1.3 auf S. 2). Damit kann die Klägerin gleichfalls nicht durchdringen. Denn der Verwaltungsgerichtshof hat weder der Klägerin noch der Entsorgungsbranche insgesamt unterstellt, sie würden im Insolvenzfall illegal handeln. Der Verwaltungsgerichtshof hat vielmehr die von der Klägerin kritisierte Textpassage im Zusammenhang mit seinen Ausführungen zum Sinn und Zweck eines Risikozuschlags gemacht, der darin bestehe, gerade auch die besonderen, im Insolvenzfall anfallenden Mehrkosten abzusichern. Er ist hierbei auf den Einwand der Klägerin eingegangen, wonach ein Risikozuschlag deswegen unangemessen sei, weil das von der Klägerin angenommene Material „in der Regel“ (dieses Zitat stammt von der Klägerin) voruntersucht bzw. aufgrund seiner Herkunft als unbelastet eingestuft sei. Diesen Einwand hat der Verwaltungsgerichtshof nicht gelten lassen mit der (nunmehr im Zulassungsantrag isoliert herausgegriffenen) Begründung, dass gerade dann, wenn ein Unternehmen – meist nach einer längeren wirtschaftlich und finanziell ungünstig verlaufenen Entwicklung – insolvent geworden sei, kein Verlass darauf sei, dass der Geschäftsbetrieb genauso abgelaufen sei, wie er „in der Regel“ verlaufen sei (BayVGH, B.v. 9.1.2019 – 22 CS 18.2003 – juris Rn. 27). Diese Begründung beschreibt schlicht einen Sachverhalt, der allgemein bekannt ist und vielfacher Erfahrung im Wirtschaftsleben entspricht: Insolvenzen treten normalerweise nicht „wie der Blitz aus heiterem Himmel“ ein, sondern sind das Ende einer allmählichen Entwicklung. In deren Verlauf wird der „regelmäßige“ Geschäftsbetrieb häufig in vielfacher Weise gestört, ohne dass damit eine Aussage über ein Verschulden oder gar ein ungesetzliches Handeln des Betriebsinhabers verbunden wäre. Es geht also nicht um legales oder illegales Handeln des Betreibers einer Abfallentsorgungsanlage, sondern um objektive Risiken beim Betrieb eines vor der Insolvenz stehenden Unternehmens.
1.5. Die Klägerin macht ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils mit der Begründung geltend, das Verwaltungsgericht gehe rechtsfehlerhaft davon aus, dass der maßgebliche Zeitpunkt für die gerichtliche Beurteilung der Zeitpunkt der letzten behördlichen Entscheidung sei. Entgegen der Ansicht des Verwaltungsgerichts sei nämlich die immissionsschutzrechtlich nachträglich verfügte Anordnung einer vom Betreiber zu stellenden Sicherheitsleistung ein Verwaltungsakt mit Dauerwirkung, dessen Rechtmäßigkeit nach der Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung zu beurteilen sei (Schriftsatz vom 28.2.2020, Nr. 2 auf S. 4 und 5). Ob diese Rechtsauffassung der Klägerin im vorliegenden Fall zutrifft, ist für die Zulassung der Berufung nicht entscheidend. Denn das Verwaltungsgericht hat zwar die gegenteilige Auffassung vertreten und (unter Hinweis auf entsprechende Gerichtsentscheidungen und Äußerungen im Schrifttum) ausgeführt, es komme auf die Beurteilung im Zeitpunkt der letzten Behördenentscheidung an, so dass die erst in der mündlichen Verhandlung vorgelegte zweite Änderung eines „Garantievertrags“ zwischen der Klägerin und einer Firma, die Garantiegeberin sein solle, nicht zu berücksichtigen sei (UA Rn. 22 auf S. 8).
Das Verwaltungsgericht hat aber als hiervon unabhängige, selbständig tragende Begründung (vgl. die Formulierung „Unabhängig davon…“) ausgeführt, dass auch die nunmehr vorliegende Garantieerklärung nicht die in den einschlägigen Vollzugshinweisen genannten Voraussetzungen erfülle, um von der Anordnung einer Sicherheitsleistung absehen zu können. Notwendig sei nach diesen Hinweisen nämlich, dass der angebotene Garantiegeber leistungsfähig sei. Vorliegend sei die Leistungsfähigkeit der angebotenen Firma indes nur behauptet, aber nicht belegt; daran ändere auch die neueste Fassung des „Garantievertrags“ nichts, wonach ein – namentlich nicht benannter – Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer beauftragt und ermächtigt werde, Zweifel an der Leistungsfähigkeit der angebotenen Firma dem Beklagten anzuzeigen. Zudem gelte diese Vereinbarung über die Ermächtigung bzw. Beauftragung eines Prüfers nur zwischen der Klägerin und der angebotenen Firma; die Vereinbarung im „Garantievertrag“ sei noch keine zivilrechtlich wirksame Verpflichtung eines Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers (vgl. UA Rn. 23 auf S. 8).
Mit dieser selbständig tragenden Begründung des Verwaltungsgerichts setzt sich die Klägerin nicht in einer den Darlegungsanforderungen § 124a Abs. 4 Satz 4 VwGO genügenden Weise auseinander. Sie trägt nur vor, „selbst dann, wenn auf den Zeitpunkt der behördlichen Entscheidung abzustellen wäre, hätte der Klage schon allein – wie geltend gemacht – auf Grundlage der Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes gem. Art. 3 Abs. 1 GG sowie des vorgelegten Eigenentsorgungskonzeptes stattgegeben werden müssen“ (Schriftsatz vom 28.2.2020, S. 5 oben). Die Klägerin legt dagegen nicht substantiiert dar, inwiefern die Entscheidungsgründe im angegriffenen Urteil hinsichtlich der Gesichtspunkte „Gleichbehandlungsgebot“ und „Eigenentsorgungskonzept“ falsche Tatsachenannahmen, rechtsfehlerhafte Erwägungen oder Begründungsdefizite aufweisen oder aus anderen Gründen Zweifel daran wecken sollen, dass das Urteil im Ergebnis richtig ist.
Was der maßgebliche Zeitpunkt für die gerichtliche Beurteilung des Streitgegenstands mit der Obliegenheit des Gerichts, gemäß § 173 VwGO i.V.m. § 278 Abs. 1 ZPO auf eine gütliche Beilegung des Rechtsstreits hinzuwirken, zu tun haben soll, ergibt sich aus dem Schriftsatz vom 6. Mai 2020 (Nr. 1.4 auf S. 3), in dem die Klägerin erstmals einen solchen Zusammenhang herstellen will, nicht.
1.6. Die Ausführungen der Klägerin unter Nr. 2 im Schriftsatz vom 6. Mai 2020 sind unbehelflich. Sie liegen z.T. außerhalb der Frist des § 124a Abs. 4 Satz 4 VwGO, verweisen z.T. nur pauschal auf früheren, schon von den Gerichten gewürdigten eigenen Vortrag der Klägerin oder wiederholen diesen, und befassen sich ausschließlich und direkt nur mit dem Schriftsatz des Landratsamts vom 30. März 2020, das der Beklagte seiner Antragserwiderung vom 22. April 2020 beigefügt hat. Der Vortrag der Klägerin unter der genannten Nr. 2 (vom 6.5.2020) lässt aber z.T. schon nicht erkennen, auf welche entscheidungstragenden Begründung des Verwaltungsgerichts er sich bezieht; noch weniger ist dargelegt, inwiefern deshalb ernstliche Zweifel daran bestehen sollen, dass das angegriffenen Urteil im Ergebnis richtig ist, oder inwiefern hieraus ein anderer Berufungszulassungsgrund folgen soll.
2. Die Klägerin macht als Verfahrensmangel im Sinn von § 124 Abs. 2 Nr. 5 VwGO geltend, das Verwaltungsgericht habe es versäumt, auf eine gütliche Beilegung des Rechtsstreits hinzuwirken; das Gericht habe damit das Gebot nach § 173 VwGO i.V.m. § 278 Abs. 1 ZPO missachtet (Schriftsatz vom 28.2.2020, Nr. 3 auf S. 5 und 6). Damit kann die Klägerin nicht durchdringen.
Es ist schon fraglich, ob daraus, dass das Verwaltungsgericht eine mündliche Verhandlung durchgeführt, in dieser Verhandlung aber nicht ausdrücklich auf eine gütliche Einigung, die eine streitige Sachentscheidung entbehrlich gemacht hätte, hingewirkt hat, ein Verfahrensmangel im Sinn des § 124 Abs. 2 Nr. 5 VwGO hergeleitet werden kann. Dem steht schon entgegen, dass der gerügte Verstoß gegen § 173 VwGO i.V.m. § 278 Abs. 1 ZPO eine bloße Soll-Vorschrift betrifft. Das Gericht „soll“ in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche Beilegung des Rechtsstreits oder einzelner Streitpunkte bedacht sein. Die Beurteilung dagegen, ob eine gütliche Beilegung möglich erscheint und wie diese gegebenenfalls zu erreichen ist, ist Teil der im Ermessen des Gerichts liegenden Verfahrensleitung (vgl. OVG NW, B.v. 14.3.2006 – 8 A 3505/05 – juris Rn. 25).
Diejenigen Fälle, in denen Oberverwaltungsgerichte bzw. Verwaltungsgerichtshöfe jeweils auf entsprechende Rüge der unterlegenen Partei die Frage eines Verfahrensmangels wegen unterbliebener Bemühungen des Erstgerichts um eine gütliche Einigung erörtert – letztlich aber verneint – haben, unterscheiden sich entweder vom vorliegenden Fall deutlich (z.B. BayVGH, B.v. 16.12.2014 – 10 ZB 14.1741 – juris Rn. 29 bis 33: Mündliche Verhandlung gemäß § 102 Abs. 2 VwGO in Abwesenheit der Beklagten und dadurch Wegfall der Möglichkeit einer vergleichsweisen Einigung in der Verhandlung) oder sie besagen, dass ein solcher Verfahrensmangel, soll er bejaht werden können, zunächst die realistische Möglichkeit einer vergleichsweisen Einigung voraussetzt (BayVGH, B.v. 12.6.2018 – 8 ZB 18.411 – juris Rn. 20). Diesen Fällen gleicht der vorliegende Fall nicht. Vielmehr hat das Verwaltungsgericht am 20. November 2019 mündlich verhandelt.
Inwiefern vorliegend eine ermessensfehlerhafte Verfahrens- oder Verhandlungsleitung des Verwaltungsgerichts zu beanstanden sein sollte, ergibt sich aus den Darlegungen der Klägerin nicht. Sie spricht nur davon, dass dem Verwaltungsgericht „ausreichend Anhaltspunkte für eine gütliche Beilegung des Rechtsstreits“ vorgelegen hätten und benennt als solche Anhaltspunkte eine in der mündlichen Verhandlung überreichte Anzeige gemäß § 15 Abs. 1 BlmSchG, wonach der für die Sicherheitsleistung maßgebliche „Anlageninput“ auf 10.000 t herabgesetzt worden sei; außerdem erwähnt die Klägerin eine „überarbeitete Garantieerklärung“. Im selben Atemzug fährt sie aber fort, der Umstand, dass diese Unterlagen erst während der mündlichen Verhandlung übergeben worden seien, liege daran, dass sich der Beklagte nicht an die am 8. November 2019 getroffene Vereinbarung gehalten habe, dass Verhandlungen zum Zweck einer außergerichtlichen Einigung geführt werden sollten (Schriftsatz vom 28.2.2020, S. 5 Mitte). Nach der Vorstellung der Klägerin hätte anscheinend das Verwaltungsgericht bestimmte in den Entscheidungsgründen zu Ungunsten der Klägerin gewertete Gesichtspunkte schon in der mündlichen Verhandlung von sich aus derart erörtern müssen, dass „ggf. noch erforderliche Ergänzungen im Garantievertrag in der Hauptverhandlung berücksichtigt und diskutiert worden“ (Schriftsatz vom 28.2.2020, S. 6 oben) bzw. „eine ggf. erforderliche weitere Anpassung des Garantievertrages hätte abschließend diskutiert und formuliert werden können“ (Schriftsatz vom 28.2.2020, S. 5 unten). Dem ist nicht zu folgen. Denn dem Protokoll über die mündliche Verhandlung (auf deren Verlauf die Klägerin in der Antragsbegründung nicht eingeht) ist zu entnehmen, dass das Verwaltungsgericht den Beteiligten seine vorläufige Rechtsauffassung dargelegt hat, wonach der Rechtsstreit entscheidungsreif sei, es der Klägerin aber unbenommen bleibe, unter Vorlage des erneut veränderten „Garantievertrags“ beim Landratsamt die Änderung des angefochtenen Bescheids bezüglich der möglichen Sicherheitsleistung zu beantragen (vgl. Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 20.11.2019, S. 3). Dass das Verwaltungsgericht Einigungswünsche, die seitens der Beteiligten geäußert worden wären, übergangen hätte, lässt sich dem Protokoll dagegen nicht entnehmen. Hinzu kommt die soeben beschriebene, in der Verhandlung den Beteiligten kundgegebene Rechtsauffassung des Verwaltungsgerichts. Angesichts dieses Umstände kann es nicht als verfahrensfehlerhaft im Sinn des § 124 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 173 VwGO und § 278 Abs. 1 ZPO angesehen werden, dass das Verwaltungsgericht nicht von sich aus auf eine vergleichsweise Beilegung des Rechtsstreits hingewirkt hat (zu einem ähnlichen Fall vgl.: OVG NW, B.v. 8.11.2007 – 6 A 554/05 – juris Rn. 22). Davon abgesehen hat der Beklagte in seiner Antragserwiderung erklärt, dass sogar die von der Klägerin in der Antragsbegründung angesprochene, nach der mündlichen Verhandlung vom 20. November 2019 dem Landratsamt übermittelte, „nochmals überarbeitete Garantieerklärung“ ungeeignet dafür sei, die Leistungsfähigkeit des eine Garantie übernehmenden Unternehmens zu belegen; damit sei auch ausgeschlossen, dass der Rechtsstreit gütlich beigelegt worden wäre (Schriftsatz vom 22.4.2020, Nr. 2 auf S. 5).
3. Die Klägerin macht ferner (auf S. 1 des Schriftsatzes vom 28.2.2020) geltend, die Rechtssache habe grundsätzliche Bedeutung (§ 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO). Zur Begründung meint sie, die Rechtsfrage, welcher Zeitpunkt für die gerichtliche Beurteilung maßgebend sei, habe grundsätzliche Bedeutung, weil diese Frage von der Kommentierung eindeutig damit beantwortet werde, dass der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung maßgebend sei, und eine hiervon abweichende Rechtsprechung nicht ersichtlich sei (Schriftsatz vom 22.4.2020, S. 4 unten). Diese Begründung trifft zum einen inhaltlich nicht zu, denn das Verwaltungsgericht hat mehrere erst- und zweitinstanzliche verwaltungsgerichtliche Entscheidungen für seine gegenteilige Rechtsauffassung zum maßgeblichen Beurteilungszeitpunkt bei der Anordnung einer Sicherheitsleistung angeführt (vgl. UA Rn. 22). Unabhängig davon fehlt es dieser Frage an der grundsätzlichen Bedeutung im Sinn des § 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO auch deswegen, weil es auf diese Frage – wie oben unter 1.5 ausgeführt – für das Verwaltungsgericht nicht angekommen ist. Die Klägerin hat nicht in einer den Anforderungen des § 124a Abs. 4 Satz 4 VwGO genügenden Weise dargelegt, dass und in welcher Weise diese oder eine andere Rechtsfrage erstens entscheidungserheblich, zweitens klärungsbedürftig und drittens über den Einzelfall hinaus von Bedeutung ist (zum Erfordernis des kumulativen Vorliegens dieser Voraussetzungen und ihrer Darlegung vgl. Happ in Eyermann, VwGO, 15. Aufl. 2019, § 124a Rn. 72).
4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 2 VwGO. Der Streitwert wurde gemäß § 47 Abs. 1 Satz 1, § 52 Abs. 1 GKG i.V.m. Nr. 1.5 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit 2013 festgesetzt (wie in der Vorinstanz und gemäß den Erwägungen im Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs vom 9.1.2019 -22 CS 18.2003 – juris Rn. 31).