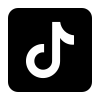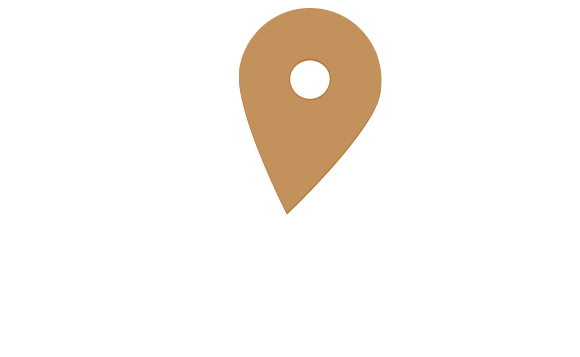Aktenzeichen 8 Ca 6967/14
RL 2011/7/EU zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr Art. 6 Abs. 1, Abs. 2
GG Art. 4 Abs. 1, 2
BGB § 247, § 288 Abs. 1, Abs. 5, §§ 293 ff., § 295, § 615 S. 1
GewO § 105, § 106 S. 1
KSchG § 1
ArbGG § 2 Abs. 1 Nr. 3a, § 12a, § 46 Abs. 2, § 61 Abs. 1, § 64 Abs. 3
ZPO § 3, § 17, § 92 Abs. 2 Nr. 1, § 138 Abs. 3, § 256 Abs. 1, § 287, § 495
Leitsatz
1 Der Arbeitgeber muss im Unternehmen klar und eindeutig eine Neutralitätspolitik verfolgen. Schreibt eine betriebliche Regelung allen Arbeitnehmern gleicher Maßen allgemein und undifferenziert vor, sich neutral zu kleiden, was das Tragen eines Kopftuchs ausschließt, liegt keine unmittelbare Diskriminierung vor. (Rn. 29) (red. LS Thomas Ritter)
2 Vom Arbeitgeber unter Berufung auf das ihm zustehende Direktionsrecht an eine einzelne Mitarbeiterin oder einen einzelnen Mitarbeiter erteilte Weisungen, entsprechend der jeweiligen Kleiderordnung und ohne auffällige großflächige religiöse, politische und sonstige weltanschauliche Zeichen am Arbeitsplatz zu erscheinen und die Arbeit aufzunehmen, sind rechtsunwirksam, da Religionen, die das Tragen von Kopfbedeckungen (zB Islam, Judentum) zwingend erfordern, eindeutig stärker diskriminiert, eingeschränkt und ungleich behandelt werden als andere Religionen die diese Verpflichtung nicht beinhalten (zB Christentum). (Rn. 29) (red. LS Thomas Ritter)
Tenor
1. Es wird festgestellt, dass die Weisung der Beklagten an die Klägerin, nach dem die Klägerin entsprechend der Kleiderordnung und ohne auffällige, großflächige, religiöse, politische und sonstige weltanschauliche Zeichen am Arbeitsplatz zu erscheinen und ihre Arbeit aufzunehmen hat, unwirksam ist.
2. Die Beklagte wird verurteilt, für den Monat Juni 2016 an die Klägerin
€ 1.214,72 brutto nebst Zinsen hieraus in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 01.07.2016 zu zahlen.
3. Die Beklagte wird verurteilt, für den Monat Juli 2016 an die Klägerin
€ 1.214,72 brutto nebst Zinsen hieraus in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 01.08.2016 zu zahlen.
4. Die Beklagte wird verurteilt, für den Monat August 2016 an die Klägerin
€ 1.214,72 brutto nebst Zinsen hieraus in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 01.09.2016 zu zahlen.
5. Die Beklagte wird verurteilt, für den Monat September 2016 an die Klägerin
€ 1.214,72 brutto abzüglich € 286,50 netto nebst Zinsen aus dem Differenzbetrag hieraus in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 01.10.2016 zu zahlen.
6. Die Beklagte wird verurteilt, für den Monat Oktober 2016 an die Klägerin
€ 1.214,72 brutto abzüglich € 573,00 netto nebst Zinsen aus dem Differenzbetrag hieraus in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 01.11.2016 zu zahlen.
7. Die Beklagte wird verurteilt, für den Monat November 2016 an die Klägerin
€ 1.214,72 brutto abzüglich € 573,00 netto nebst Zinsen aus dem Differenzbetrag hieraus in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 01.12.2016 zu zahlen.
8. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin weitere € 440,71 brutto nebst Zinsen hieraus in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 15.10.2016 zu zahlen.
9. Die Beklagte wird verurteilt, für den Monat Dezember 2016 an die Klägerin
€ 1.214,72 brutto abzüglich € 573,00 netto nebst Zinsen aus dem Differenzbetrag hieraus in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 01.01.2017 zu zahlen.
10. Die Beklagte wird verurteilt, für den Monat Januar 2017 an die Klägerin
€ 391,84 brutto abzüglich € 191,00 netto nebst Zinsen aus dem Differenzbetrag hieraus in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 01.02.2017 zu zahlen.
11. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
12. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
13. Der Streitwert wird auf 8.633,81 € festgesetzt.
14. Die Berufung wird nicht gesondert zugelassen.
Gründe
Die Klage ist zulässig. Der Rechtsweg zu den Arbeitsgerichten ist eröffnet und das Arbeitsgericht Nürnberg – Gerichtstag Ansbach – im Urteilsverfahren örtlich zuständig ( §§ 2 Abs. 1 Nr. 3 a, 46 Abs. 2 ArbGG, 17 ZPO).
Die auf Feststellung der Rechtswidrigkeit der Weisung vom Juli 2016 gerichtete Klage in Ziffer 1. ist zulässig ( ErfKo, Preis, 16. Aufl., 2016, Gew 320, Rn. 7). Das nach § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse ist gegeben, weil die Klägerin ein rechtliches Interesse daran hat, dass das Rechtsverhältnis durch richterliche Entscheidung alsbald festgestellt wird, da sich die Beklagte der Wirksamkeit der Weisung berühmt. Auch einzelne Beziehungen und Folgen eines Rechtsverhältnisses können Gegenstand einer Feststellungsklage sein ( BAG, Urteil vom 19.06.1985, Az.: 5 AZR 57/84 = DB 86,132). Die Klägerin macht mit ihrer Antragsformulierung deutlich, welche konkrete Weisung hinsichtlich welcher konkreten Tätigkeit sie anfechten möchte. Dabei ist es auch möglich, im Wege der negativen Feststellungsklage geltend zu machen, dass der AG die Weisung nicht erteilen darf. Die Grenzen des Direktionsrechts sind in vollem Umfang gerichtlich nachprüfbar.
Die Klage ist begründet.
Die der Klägerin im Juli 2016 von der Beklagten unter Berufung auf das ihr zustehende Direktionsrecht erteilte Weisung, entsprechend der Kleiderordnung und ohne auffällige großflächige religiöse, politische und sonstige weltanschauliche Zeichen am Arbeitsplatz zu erscheinen und ihre Arbeit aufzunehmen, ist rechtsunwirksam.
Zwar war die Beklagte arbeitsvertraglich nicht daran gehindert, nach Maßgabe des § 106 GewO i.V.m Ziffer 1. AV der Klägerin in Ausübung des Direktionsrechts andere zumutbare Tätigkeiten als Verkaufsberaterin und Kassiererin auch an einem anderen Arbeitsort zuzuweisen. Bei der Ausübung des arbeitgeberseitigen Weisungsrechts ist zum Einen festzustellen, ob ein bestimmter Tätigkeitsinhalt und Tätigkeitsort vertraglich festgelegt sind und welchen Inhalt ein gegebenenfalls vereinbarter Versetzungsvorbehalt hat ( BAG, Urteil vom 26.09.2012, Az.: 10 AZR 311/11 = NZA-RR 2013, 403). Der Ausübung des Direktionsrechts steht nicht entgegen, dass die Klägerin seit mehr als 9 Jahren die Tätigkeit als Verkaufsberaterin und Kassiererin ausgeübt hat. Die Arbeitspflicht der Klägerin hat sich nicht dadurch auf diese Tätigkeiten konkretisiert, weil diese seit Vertragsbeginn die wesentlichen gewesen sind. Die Nichtausübung des Direktionsrechts über einen längeren Zeitraum schafft regelmäßig keinen Vertrauensbestand dahingehend, dass der Arbeitgeber von diesem vertraglich oder gesetzlich eingeräumten Recht in Zukunft keinen Gebrauch mehr machen will. Die Nichtausübung des Direktionsrechts hat keinen Erklärungswert. Nur beim Hinzutreten besonderer Umstände, auf Grund derer der Arbeitnehmer darauf vertrauen darf, dass er nicht in anderer Weise eingesetzt werden soll, kann es durch konkludentes Verhalten zu einer vertraglichen Beschränkung der Ausübung des Direktionsrechts kommen ( BAG, Urteil vom 28.08.2013, Az.: 10 AZR 569/12 = NZA-RR 2014, 181, m.w.N .). Derartige besondere Umstände hat die Klägerin nicht vorgetragen und sind auch nicht ersichtlich. Dies ist letztlich jedoch auch nicht ( mehr) Klagegegenstand, sondern die Frage, ob sich die Beklagte zur Begründung der Ausübung ihres Direktionsrechts, welches ihr auch bei Weisungen hinsichtlich der Ordnung und des Verhaltens der Arbeitnehmer zusteht, vorliegend auf § 106 GewO berufen kann.
Die geschuldete Arbeitsleistung bestimmt sich nach der zulässigen Ausübung des Weisungsrechts durch den Arbeitgeber ( Erf Ko, Preis, a.a.O., § 106 GewO 320 Rn. 2). Auf Grund seines Weisungsrechts kann der Arbeitgeber eine im Arbeitsvertrag nur abstrakt umschriebene Leistungspflicht des Arbeitnehmers nach Zeit, Ort und Art der Leistung einseitig näher bestimmen soweit diese Leistungspflicht nicht durch Gesetz oder Vertrag festgelegt ist; der Regelung des § 106 Satz 1 GewO kommt insoweit klarstellende Bedeutung zu ( BAG, Urteil vom 24.02.2011, Az.: 2 AZR 636/09 = NZA 2011, 1087). Auch die Frage, in welcher Kleidung der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung verrichtet, gehört zum Inhalt der Arbeitsleistung und ist Weisungen des Arbeitgebers zugänglich ( ErfKo, Preis, a.a.O. § 106 GewO 320 Rn. 15). Zwar kann das Tragen einer bestimmten Kleidung zur vertragsgemäßen Erfüllung der Arbeitsleistung geboten sein ( BAG, Beschluss vom 03.02.2007, Az.: 1 ABR 18/06 = NZA 2007, 640). Ebenso kann es hierzu geboten sein, es zu unterlassen, sich in einer bestimmten Art zu kleiden. Eine bestimmte Bekleidung kann – ohne besondere vertragliche Vereinbarung – eine arbeitsleistungsbezogene Nebenpflicht des Arbeitnehmers darstellen, die der Arbeitspflicht nahekommt. Bekleidungsobliegenheiten können sich auch aus der Tätigkeitsbeschreibung im Arbeitsvertrag ergeben. In diesem Fall sind sie Teil der arbeitsvertraglichen Hauptleistungspflicht (vgl. Brose/Greiner/Preis, NZA 2011, 369 ff.). Bei der Bestimmung sich aus dem Arbeitsvertrag ergebender Handlungs- bzw. Unterlassungspflichten in Bezug auf die Kleidung während der Arbeitszeit gebietet der Schutz des Arbeitnehmers vor Überforderung eine Abwägung der Interessen beider Vertragsparteien unter Berücksichtigung der widerstreitenden Grundrechtspositionen und der Besonderheiten des jeweiligen Einzelfalls. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Die Beklagte hat mit ihrer Weisung an die Klägerin im Juli klargestellt, dass sie entsprechend der Kleiderordnung und ohne auffällige großflächige religiöse, politische und sonstige weltanschauliche Zeichen am Arbeitsplatz zu erscheinen und ihre Arbeit aufzunehmen habe, das Tragen eines religiös motivierten Kopftuches während der Arbeitszeit demnach nicht gestattet ist. Sie solle vielmehr „neutral und entsprechend der geltenden Kleiderordnung in angemessener Kleidung professionell und leicht erkennbar gegenüber Kunden auftreten“. Diese Anordnung ist vorliegend vom Weisungsrecht nicht gedeckt. Ob das Verbot, während der Arbeit ein religiös motiviertes Kopftuch zu tragen, bereits aus der nach wie vor geltenden Kleiderordnung in der Fassung aus dem Jahr 2013 folgt, kann dahinstehen. Zu Gunsten der Klägerin kann davon ausgegangen werden, dass die Beklagte aus dieser Kleiderordnung keine weitergehenden Rechte ableiten kann als durch die Ausübung des arbeitgeberseitigen Direktionsrechts ( LAG Hamm, Urteil vom 17.02.2012, Az.: 18 Sa 867/11 = NZA 2014, 1407). Mit dieser Weisung hat die Beklagte die Grenzen billigen Ermessens gem. § 106 Satz 1 GewO nicht gewahrt. Dem AG obliegt die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen billigen Ermessens ( BAG, Urteil vom 21.07.2009, Az.: 9 AZR 404/08 = NZA 2009, 1369). Eine Weisung entspricht billigem Ermessen, wenn der Arbeitgeber bei seiner Entscheidung die wesentlichen Umstände des Einzelfalles abgewogen und die beiderseitigen Interessen angemessen berücksichtigt hat; dabei ist der Zeitpunkt maßgeblich, in dem der Arbeitgeber seine Entscheidung trifft ( BAG, Urteil vom 24.02.20011, Az.: 2 AZR 636/09, a.a.O.). Die in § 106 Satz 1 GewO geforderte Billigkeit wird inhaltlich durch die Grundrechte und damit auch durch das Grundrecht der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit des Art. 4 Abs. 1 GG und die Gewährleistung der ungestörten Religionsausübung des Art. 4 Abs. 2 GG mitbestimmt. Bei der Ausübung seines Weisungsrechts muss der Arbeitgeber die Glaubensfreiheit des Arbeitnehmers beachten, die durch Art. 4 Abs. 1 und 2 GG grundrechtlich geschützt ist; der Arbeitgeber muss auf einen beachtlichen Glaubens- oder Gewissenskonflikt, den der Arbeitnehmer offenbart, Rücksicht nehmen ( BAG, a.a.O.). Die somit erforderliche Interessenabwägung führt nach Ansicht der Kammer vorliegend zu dem Ergebnis, dass das Interesse der Beklagten, der Klägerin während der Arbeit das Tragen eines religiös motivierten Kopftuches zu untersagen, gegenüber dem Interesse der Klägerin, aus religiösen Gründen während der Arbeit ein Kopftuch zu tragen, zurückzutreten hat. Das gebietet die verfassungskonforme Auslegung und Anwendung des § 106 Satz 1 GeWO. GewO. Das bei der Ausübung des Leistungsbestimmungsrechts zu wahrende billige Ermessen wird inhaltlich durch die Grundrechte des Arbeitnehmers mitbestimmt. Kollidieren diese mit dem Recht des Arbeitgebers, dem Arbeitnehmer im Rahmen der gleichfalls grundrechtlich geschützten unternehmerischen Betätigungsfreiheit ( Art. 12 GG ) eine von der vertraglichen Vereinbarung gedeckte Tätigkeit zuzuweisen, sind die gegensätzlichen Rechtspositionen grundrechtskonform auszugleichen. Dabei sind die kollidierenden Grundrechte in ihrer Wechselwirkung zu sehen und so zu begrenzen, dass sie für alle Beteiligten möglichst weitgehend wirksam werden. Es ist die Intensität des umstrittenen Eingriffs ebenso zu berücksichtigen wie der Umstand, dass die Vertragspartner mit dem Abschluss des Vertrags in eine Begrenzung grundrechtlicher Freiheiten eingewilligt haben ( BAG, Az.: 2 AZR 472/01, a.a.O ). Ob und inwieweit der Arbeitgeber bei der Ausübung seines Weisungsrechts auf die Glaubensüberzeugungen des Arbeitnehmers Rücksicht nehmen muss, ist damit eine Frage des Einzelfalls. Art. 4 GG garantiert in Abs. 1 die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses, in Abs. 2 das Recht der ungestörten Religionsausübung. Beide Absätze des Art. 4 GG enthalten ein umfassend zu verstehendes einheitliches Grundrecht. Es erstreckt sich nicht nur auf die innere Freiheit, zu glauben oder nicht zu glauben, sondern auch auf die äußere Freiheit, den Glauben zu bekunden und zu verbreiten. Dazu gehört auch das Recht des Einzelnen, sein gesamtes Verhalten an den Lehren seines Glaubens auszurichten und seiner inneren Glaubensüberzeugung gemäß zu handeln ( BVerfG, 24.09.2003, Az.: 2 BvR 1436/02 ). Das Tragen eines Kopftuchs aus religiöser Überzeugung fällt in den Schutzbereich der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit ( BAG, Urteil vom 10.10.2002, Az.: 2 AZR 472/01 = NZA 2003, 483 ), das Interesse der Klägerin, während der Arbeit aus religiösen Gründen ein Kopftuch zu tragen, ist durch Art. 4 Abs. 1 und 2 GG geschützt. Die grundrechtlich geschützte Glaubensfreiheit umfasst nicht nur die innere Freiheit, zu glauben oder nicht zu glauben, sondern auch das Recht des Einzelnen, sein gesamtes Verhalten an den Lehren seines Glaubens auszurichten und seiner inneren Glaubensüberzeugung gemäß zu handeln ( BVerfG, Beschluss vom 19.10.1971- 1 BvR 387/65 ). Wegen der Bedeutung, die Muslime dem Kopftuch beilegen, gilt es als Sinnbild einer bestimmten Glaubensüberzeugung, als Ausdruck des Bekenntnisses der Trägerin zum islamischen Glauben und damit als sichtbares Zeichen für die Ausübung ihrer Religion ( ErfKo, Schmidt, Art. 4 GG 10, Rn. 12). Dabei kommt es nicht darauf an, ob das Tragen eines Kopftuchs Ausdruck eines zwingenden religiösen Gebots des Korans ist, was innerhalb des Kreises islamischer Glaubensgelehrter umstritten sein mag. Maßgeblich ist allein, dass das Verhalten überhaupt von einer wirklichen religiösen Überzeugung getragen und nicht anders motiviert ist. Unter den Schutzbereich des Art. 4 GG fallen auch Verhaltensweisen, die nicht allgemein von den Gläubigen geteilt werden ( BAG, Urteil vom 10.10.2002, a.a.O. ). Allerdings kann die nicht ernsthafte, möglicherweise nur vorgeschobene Berufung auf bestimmte Glaubensinhalte und -gebote keine Beachtung finden. Es muss erkennbar sein, dass der Arbeitnehmer, der sich auf einen Glaubenskonflikt beruft, den von ihm ins Feld geführten Ge- oder Verboten seines Glaubens absolute Verbindlichkeit beimisst, dass es sich also um eine für ihn zwingende Verhaltensregel handelt, von der der Betroffene nicht ohne innere Not absehen kann (BAG, Az.: 2 AZR 636/09 a.a.O , LAG Hamm, Urteil vom 20.04.2011, Az.: 4 Sa 2230/10; LAG Schleswig- Holstein, Urteil vom 20.01.2009, Az.: 5 Sa 270/08). Anhaltspunkte hierfür sind nicht feststellbar. Die Klägerin befindet sich nach dem unbestrittenen Sachvortrag ( § 138 Abs. 3 ZPO ) in einem ernsthaften Glaubenskonflikt und betrachtet das Tragen eines Kopftuchs als für sich als essentiellen Bestandteil ihrer Glaubensrichtung verbindlich von den Regeln ihrer Religion vorgegeben. Das Befolgen dieser Bekleidungsregel ist für sie Ausdruck ihres religiösen Bekenntnisses. Sie ist bereit, die Unwägbarkeiten des vorliegenden Rechtsstreits und damit ein erhebliches wirtschaftliches Risiko auf sich zu nehmen. Die Klägerin hat das Angebot der Beklagten, die Arbeit ohne das Tragen eines Kopftuches fortzusetzen, nicht angenommen, sondern stattdessen den Verlust ihres Arbeitseinkommens in Kauf genommen. Dass sie bei Abschluss des Arbeitsvertrages den hier streitgegenständlichen Konflikt hätte vorhersehen können, nimmt ihr nicht die Möglichkeit, sich auf Art 4 GG zu berufen. Zwar kann es dem Arbeitnehmer verwehrt sein, einen Glaubenskonflikt geltend zu machen, wenn er bei Vertragsschluss bereits positiv wusste, dass er die vertraglich eingegangenen Verpflichtungen aufgrund seiner Glaubensüberzeugungen nicht würde erfüllen können. Der Umstand, dass die Möglichkeit eines Glaubenskonfliktes für den Arbeitnehmer vorhersehbar war, nimmt jedoch dessen späterer Erklärung, er berufe sich nunmehr auf seine Glaubensüberzeugung, nichts von ihrer rechtlichen Beachtlichkeit; der aktuelle Glaubenskonflikt des Arbeitnehmers ist deshalb nicht weniger bedeutsam im Sinne des Art. 4 GG. Glaubensüberzeugungen können sich ändern (BAG, Az.: 2 AZR 636/09, a.a.O.). Der Arbeitgeber muss einen ihm offenbarten und beachtlichen Glaubens- oder Gewissenskonflikt des Arbeitnehmers bei der Ausübung seines Weisungsrechts berücksichtigen. Die Relevanz und Gewichtigkeit der Gewissensbildung unterliegt dabei keiner gerichtlichen Kontrolle (BAG, Urteil vom 22.05.2003, Az.: 2 AZR 426/02 = AP Nr. 18 zu § 1 KSchG Wartezeit).
In Anwendung dieser Grundsätze vermochte die Beklagte keine Rechtfertigungsgründe darzulegen, die eine derartige Einschränkung der Religionsfreiheit der Klägerin rechtfertigen würden. Insbesondere sind betriebliche Ablaufstörungen, Streitigkeiten zwischen den Mitarbeitern und Beschwerden von Kunden nur pauschal behauptet und nicht ausreichend unter Beweis gestellt worden. Das Grundrecht der Religionsfreiheit kann nicht derart eingeschränkt werden, wenn die Beklagte – wie vorliegend – Kundenbeschwerden und Streitigkeiten zwischen Mitarbeitern lediglich vermutet, ohne tatsächliche konkrete Anhaltspunkte hierfür hinreichend darlegen zu können.
Zwar ergibt sich aus der Rechtsprechung des EuGH ( Urteil. v. 14.3.2017, Az.: C-157/15 = NZA 2017,373), dass das grundsätzliche Verbot, ein islamisches Kopftuch bei der Arbeit zu tragen, welches sich aus einer internen Regel eines privaten Unternehmens ergibt, die allgemein das sichtbare Tragen jedes politischen, philosophischen oder religiösen Zeichens am Arbeitsplatz verbietet, gerechtfertigt werden kann aus der betrieblichen Entscheidung heraus, eine allgemeine Neutralitätspolitik zu verfolgen.
Der EuGH hat in dieser Entscheidung folgende Rechtsgrundsätze aufgestellt:
„Art. 2 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf ist dahin auszulegen, dass das Verbot, ein islamisches Kopftuch zu tragen, das sich aus einer internen Regel eines privaten Unternehmens ergibt, die das sichtbare Tragen jedes politischen, philosophischen oder religiösen Zeichens am Arbeitsplatz verbietet, keine unmittelbare Diskriminierung wegen der Religion oder der Weltanschauung im Sinne dieser Richtlinie darstellt.
Eine solche interne Regel eines privaten Unternehmens kann hingegen eine mittelbare Diskriminierung im Sinne von Art. 2 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 2000/78 darstellen, wenn sich erweist, dass die dem Anschein nach neutrale Verpflichtung, die sie enthält, tatsächlich dazu führt, dass Personen mit einer bestimmten Religion oder Weltanschauung in besonderer Weise benachteiligt werden, es sei denn, sie ist durch ein rechtmäßiges Ziel wie die Verfolgung einer Politik der politischen, philosophischen und religiösen Neutralität durch den Arbeitgeber im Verhältnis zu seinen Kunden sachlich gerechtfertigt, und die Mittel zur Erreichung dieses Ziels sind angemessen und erforderlich; dies zu prüfen, ist Sache des vorlegenden Gerichts.“
Nach dieser Rechtsprechung werden keine konkreten Anhaltspunkte gefordert, um eine Beschränkung der Religionsfreiheit zu rechtfertigen. Allerdings muss klar und eindeutig eine Neutralitätspolitik im Unternehmen verfolgt werden. Schreibt die betriebliche Regelung allen Arbeitnehmern gleicher Maßen allgemein und undifferenziert vor, sich neutral zu kleiden, was das Tragen eines Kopftuchs ausschließt, liegt keine unmittelbare Diskriminierung vor. Diese Voraussetzungen der Verfolgung einer Neutralitätspolitik sind vorliegend jedenfalls nicht feststellbar. Die Beklagte vermochte nicht zur Überzeugung der Kammer ( § 287 ZPO) hinreichend darlegen, dass sie tatsächlich in ihrem Betrieb eine bisher offensichtlich nicht betriebene Neutralitätspolitik als nunmehrige betriebliche Entscheidung verfolgt. Die letzte Weisung der Beklagten, die sich auf die Neutralitätspolitik beruft, gründet gerade nicht auf einer internen Regelung, die allgemein und undifferenziert auf alle Mitarbeiter der Beklagte wirkt. Dies ergibt sich zum einen daraus, dass die mit Schriftsatz vom 06. Juni 2016 angekündigte Änderung der betrieblichen Ordnung durch die Beklagte, mit dem Inhalt an alle Mitarbeiter ohne sichtbare, religiöse, politische und sonstige weltanschauliche Zeichen am Arbeitsplatz zu erscheinen, bereits zum 07. Juli 2016 nicht mehr in Kraft war. Zum Anderen kann sich die Weisung auch nicht auf die kodifizierte Betriebsordnung bei der Beklagten stützen, ganz unabhängig davon seit wann diese betriebliche Ordnung überhaupt in Kraft ist. Nach dieser Ordnung ergibt sich lediglich, dass das Tragen legerer Freizeitbekleidung, wie insbesondere Training- und Jogginganzüge sowie „Kopfbedeckungen aller Art bei Kundenkontakt“ nicht gestattet werden. Auch hierbei handelt es sind nicht um eine ausreichende interne Regelung, die die Verfolgung einer Neutralitätspolitik hinreichend zu beweisen vermag. Diese Regelung zielt zur Überzeugung der Kammer ganz offensichtlich auf die Gewährleistung einer ordentlichen und seriösen Arbeitsbekleidung und nicht auf die Wahrung politischer, religiöser und weltanschaulicher Neutralität. Im Vordergrund standen erkennbar allgemeine Ordnungs- und Betriebsverhaltensregeln für das äußere Erscheinungsbild der Mitarbeiter beim Auftreten iSd Kundenzufriedenheit und des Images. Eine klare Regelung hinsichtlich religiöser Neutralität, insbesondere bei Mitarbeitern mit Kundenkontakt hat die Beklagte nur behauptet, eine solche aber nicht durch ein allgemeinverbindlich betriebsöffentlich oder unternehmensweit verpflichtend bekanntgemachtes unternehmerisches Konzept untermauert. Erst im Streitfall im Zusammenhang mit der Weisung an die Klägerin wurde ein solches überhaupt erst zur Begründung des Kopftuchverbots angeführt. Wollte man diese Regelung in religiöser Hinsicht auslegen, wäre sie unmittelbar diskriminierend, da sie nicht allgemein und undifferenziert wirkt. Religionen, die das Tragen von Kopfbedeckungen ( z.B. Islam, Judentum) zwingend erfordern, werden eindeutig stärker diskriminiert, eingeschränkt und ungleich behandelt als andere Religionen die diese Verpflichtung nicht beinhalten ( z.B. Christentum). Die Weisung kann überdies auch nicht auf der angeblich allgemein im Betrieb geltenden Verpflichtung beruhen, die das Tragen politischer, religiöser und weltanschaulicher Zeichen verbietet. Da es sich bei der Verpflichtung um eine mündliche Anordnung handelt, die in keiner Form schriftlich kodifiziert ist, ist nicht ausreichend erkennbar, ob diese Verpflichtung tatsächlich besteht und ob alle Mitarbeiter gleichermaßen verpflichtet werden, sich daran zu halten. Auf Grund der fehlenden Kodifizierung bestehen bereits Zweifel an einer essentiellen Ernsthaftigkeit der behaupteten Neutralitätspolitik. Die Beklagte könnte diese unschwer kodifizieren und zum Bestandteil des Arbeitsvertrags machen ( § 105 GewO). Die Beklagte hätte daher zudem prüfen müssen, das Direktionsrecht eingeschränkt dahin auszuüben, die Klägerin mit Kopftuch anderweitig zu beschäftigen. Dies hat sie ernsthaft gar nicht in Erwägung gezogen, außer zum Zweck der gütlichen Einigung.
Nach alldem erweist sich die Weisung als rechtswidrig und unwirksam.
Der Klägerin steht somit Entgeltfortzahlung wegen der verweigerten Beschäftigung ein Anspruch auf die begehrte Entgeltzahlung unter dem Gesichtspunkt des Annahmeverzuges zu ( §§ 615 Satz 1, 293 ff. BGB). Danach ist der Arbeitgeber verpflichtet, die vereinbarte Vergütung zu zahlen, wenn er mit der Annahme der Dienste in Verzug kommt. Voraussetzung dafür ist, dass er die ihm angebotene Leistung nicht annimmt ( § 293 BGB). Die Beklagte ist in Annahmeverzug geraten, weil die Klägerin die am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und in der richtigen Weise angebotene Leistung nicht angenommen hat. Gemäß § 294 muss die Leistung dem Gläubiger so, wie sie zu bewirken ist, tatsächlich angeboten werden, nach § 295 BGB ist ein wörtliches Angebot unter den dort genannten Voraussetzungen ausreichend. Die leistungsbereite undwillige Klägerin wollte die Arbeitsleistung stets mit der Maßgabe erbringen, dass sie bei der Arbeit aus religiösen Gründen zulässiger Weise ein Kopftuch trägt und Klägerin hat der Beklagten sowohl am 21.06.2016 als auch am 18.10.2016 ihre Arbeitskraft persönlich in rechtmäßiger Weise mit Kopftuch angeboten. Die Beklagte hat jedoch aufgrund einer rechtswidrigen Weisung die Arbeitskraft zu Unrecht abgelehnt und ist so in Annahmeverzug geraten.
Die Höhe des Anspruchs ist im Wesentlichen unbestritten, ein Schriftsatznachlass zu Ziffer 16 des klägerischen Schriftsatzes vom 10.03.2017 war in Ermangelung substanziierten Sachvortrags nicht veranlasst.
Der Anspruch auf Verzugszinsen ergibt sich aus §§ 288 Abs. 1, 247 BGB.
Die Klägerin hat hingegen keinen Anspruch auf Zahlung der geltend gemachten Verzugspauschale gem. § 288 Abs. 5 BGB.
Danach hat der Gläubiger einer Entgeltforderung bei Verzug des Schuldners, wenn dieser kein Verbraucher ist, ungeachtet eines Anspruchs auf Verzugszinsen oder sonstigen Verzugsschadens einen Anspruch auf Zahlung einer Pauschale in Höhe von 40 Euro. Mit dieser Vorschrift ist Art. 6 Abs. 1 und 2 der Europäischen Richtlinie 2011/7/EU zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr in deutsches Recht umgesetzt worden.Eine Anwendbarkeit dieser Norm ist im Arbeitsrecht heftig umstritten. Für deren Anwendbarkeit spricht der klare und eindeutige Wortlaut, der dem Arbeitnehmer die Pauschale bei einer Entgeltforderung ausnahmslos zuspricht. Hätte der Gesetzgeber gewollt, dass die Norm im Arbeitsrecht nicht durchgreift, hätte er wohl eine Ausnahmeregelung in die Norm aufgenommen ( vgl. LAG Köln, Urteil vom 22.11.2016, Az.: 12 Sa 524/16 = ZTR 17, 105; LAG BadenWürttemberg, Urteil vom 13.10.2016, Az.: 3 Sa 34/16 = ArbR 2016, 579). Die Kammer jedoch folgt der Gegenmeinung, wonach die Verzugspauschale im Arbeitsrecht wegen Unvereinbarkeit mit dem Ausschluss der Kostenerstattung im arbeitsgerichtlichen Verfahren erster Instanz gemäß § 12a ArbGG unanwendbar ist ( Palandt/Grüneberg, 75. Aufl. 2016, § 288 Rn. 15, Diller in NZA 2015, 1095, ArbG Düsseldorf, Urteil vom 12.05.2016, Az.: 2 Ca 5416/15, ArbG Nürnberg, Urteil vom 11.11.2016, Az.: 12 Ca 6016/15 = NZA-RR 2017, 185). Dies folgt bereits zum Einen aus dem Sinn und Zweck der Verzugspauschale. Nach der ausdrücklichen Regelung in Art. 6 Abs. 2 der Richtlinie 2011/7/EU stellt die Verzugspauschale eine Entschädigung für die Beitreibungskosten des Gläubigers dar. Auch die Begründung des Regierungsentwurfs zur Einführung der Verzugspauschale verweist ausdrücklich darauf, dass die Pauschale Ersatz für Beitreibungskosten bzw. Rechtsverfolgungskosten des Gläubigers darstellen soll. Dieser Zweck ergibt sich ferner aus § 288 Abs. 5 Satz 3 BGB, wonach die Pauschale auf Schadensersatz für Rechtsverfolgungskosten anzurechnen ist.
Der Sinn und Zweck steht im Widerspruch zu § 12a Abs. 1 Satz 1 ArbGG, der im Urteilsverfahren erster Instanz einen Anspruch der obsiegenden Partei auf Entschädigung wegen Zeitversäumnis und auf Erstattung der Kosten für die Zuziehung eines Prozessbevollmächtigten oder Beistands ausschließt. Daraus folgt, dass der Gesetzgeber im Arbeitsrecht grundsätzlich die Erstattung der Rechtsverfolgungskosten in der ersten Instanz ausschließen wollte. Anhaltspunkte, dass § 288 Abs. 5 BGB an diesem Grundsatz etwas ändern wollte, sind nicht ersichtlich.
Nach alldem war der Klage überwiegend stattzugeben.
Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 46 Abs. 2 ArbGG, 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO.
Die Streitwertentscheidung folgt aus §§ 61 Abs. 1, 46 Abs. 2 ArbGG, 495, 3 ff. ZPO i.V.m. I Nr. 12 Streitwertkatalog für die Arbeitsgerichtbarkeit vom 05.04.2016.
Gründe für eine gesonderte Berufungszulassung liegen nicht vor ( § 64 Abs. 3 ArbGG). Im Übrigen wird auf die Rechtsmittelbelehrungverwiesen.