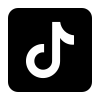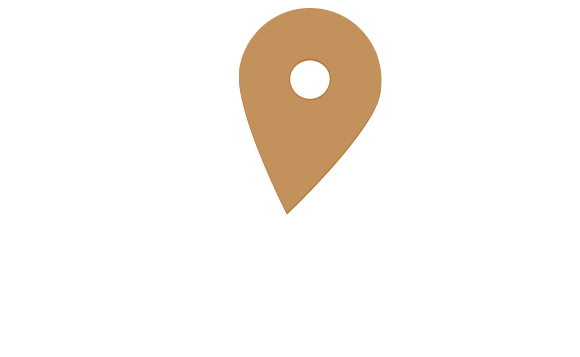Aktenzeichen M 25 K 17.45748
Leitsatz
1 Ein bewaffneter Konflikt herrscht nicht im Westen der DR Kongo und insbesondere nicht in der Hauptstadt Kinshasa. (Rn. 30) (redaktioneller Leitsatz)
2 Diabetes mit Bluthochdruck ist in der DR Kongo behandelbar; Insulin ist ohne Weiteres erhältlich. (Rn. 41) (redaktioneller Leitsatz)
Tenor
I. Die Klage wird abgewiesen.
II. Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.
III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe des vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht die Beklagte vorher Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
Gründe
Über den Rechtsstreit konnte aufgrund der mündlichen Verhandlung am 1. August 2018 entschieden werden, obwohl für die Beklagte niemand erschienen ist, da in der Ladung zur mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen worden war, dass auch im Fall des Nichterscheinens der Beteiligten verhandelt und entschieden werden könne (§ 102 Abs. 2 VwGO). Die Beteiligten sind form- und fristgerecht geladen worden.
Die zulässige Klage bleibt ohne Erfolg, da der angegriffene Bescheid des Bundesamts rechtmäßig ergangen ist und die Klägerin nicht in eigenen Rechten verletzt (§ 113 Abs. 1 und 5 VwGO).
1. Unabhängig von der Frage, ob zwischen der Klägerin und Herrn … … … K. eine rechtsgültige Ehe besteht und ob die Voraussetzungen des Art. 11 Verordnung (EU) Nr. 604/2013 (Dublin III-VO), den die Dublin Unit UK bei der Prüfung des Übernahmeersuchens zugrunde gelegt hat, bzw. des hier vorliegend wohl einschlägigen Art. 9 Dublin III-VO vorliegen, ist die Bundesrepublik zum maßgeblichen Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung für die Durchführung des Asylverfahrens der Klägerin zuständig. Gemäß Art. 21 Abs. 1 Dublin III-VO kann ein Mitgliedstaat, in dem ein Antrag auf internationalen Schutz gestellt wurde, einen anderen Mitgliedstaat spätestens innerhalb von drei Monaten nach Antragstellung im Sinne des Art. 20 Abs. 2 Dublin III-VO ersuchen, den Antragsteller aufzunehmen, wenn er den anderen Mitgliedstaat für die Prüfung des Antrags zuständig hält. Wird das Gesuch um Aufnahme eines Antragstellers nicht innerhalb der genannten Frist unterbreitet, so ist der Mitgliedstaat, in dem der Antrag auf internationalen Schutz gestellt wurde, für die Prüfung des Antrags zuständig. Die Klägerin hat am 5. Juli 2016 Asylantrag im Bundesgebiet gestellt, jedoch hat das Bundesamt das Übernahmeersuchen an Großbritannien erst am 20. November 2017 gestellt und damit nicht innerhalb der Dreimonatsfrist des Art. 21 Abs. 1 Dublin III-VO. Daher ist die Bundesrepublik nach Art. 21 Abs. 1 UA 3 Dublin III-VO für die Durchführung des Asylverfahrens der Klägerin zuständig.
2. Die Klägerin hat im maßgeblichen Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung (§ 77 Abs. 1 Satz 1 AsylG) auch keinen Anspruch auf die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach § 3 AsylG, die Zuerkennung subsidiären Schutzes nach § 4 AsylG oder die Feststellung nationaler Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5, 7 AufenthG.
Die vom Bundesamt nach Maßgabe des § 34 AsylG i.V.m. § 59 AufenthG erlassene Abschiebungsandrohung ist rechtmäßig.
Das Gericht nimmt hinsichtlich der Gründe auf den Bescheid Bezug (§ 77 Abs. 2 AsylG). Lediglich ergänzend wird ausgeführt:
a) Ein Ausländer ist nach § 3 Abs. 1 AsylG Flüchtling im Sinne des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, wenn er sich aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, politischer Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe außerhalb seines Herkunftslandes befindet. Eine Verfolgung kann dabei gem. § 3c AsylG ausgehen von einem Staat, Parteien oder Organisationen, die den Staat oder wesentliche Teile des Staatsgebietes beherrschen oder von nichtstaatlichen Akteuren, sofern die zuvor genannten Akteure einschließlich internationaler Organisationen erwiesenermaßen nicht in der Lage oder willens sind, im Sinne des § 3d AsylG Schutz vor der Verfolgung zu bieten, und dies unabhängig davon, ob in dem Land eine staatliche Herrschaftsmacht vorhanden ist oder nicht. Weiter darf für den Ausländer keine innerstaatliche Fluchtalternative bestehen, § 3e AsylG.
Das Gericht muss sowohl von der Wahrheit – und nicht nur von der Wahrscheinlichkeit – des vom Schutzsuchenden behaupteten individuellen Schicksals als auch von der Richtigkeit der Prognose einer mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit drohenden politischen Verfolgung bzw. Gefährdung die volle Überzeugung gewinnen. Auf die Glaubhaftigkeit seiner Schilderung und Glaubwürdigkeit seiner Person kommt es entscheidend an. Seinem persönlichen Vorbringen und dessen Würdigung ist daher gesteigerte Bedeutung beizumessen. Der Schutzsuchende muss die persönlichen Umstände seiner Verfolgung und Furcht vor einer Rückkehr hinreichend substantiiert, detailliert und widerspruchsfrei vortragen, er muss kohärente und plausible wirklichkeitsnahe Angaben machen (vgl. BVerfG, B.v. 7.4.1998 – 2 BvR 253/96 – juris). Auch unter Berücksichtigung des Herkommens, Bildungsstands und Alters muss der Schutzsuchende im Wesentlichen gleichbleibende, möglichst detaillierte und konkrete Angaben zu seinem behaupteten Verfolgungsschicksal machen.
Das Bundesamt hat den Asylantrag im Wesentlichen mit der Begründung abgelehnt, dass die Klägerin kein Verfolgungsschicksal glaubhaft vorgetragen hat. Diese Annahme des Bundesamtes ist nach Durchführung der mündlichen Verhandlung nachvollziehbar. Der Vortrag der Klägerin begründet auch zur Überzeugung des Gerichts kein glaubhaftes und asylrechtlich relevantes Verfolgungsschicksal.
Im Vortrag hinsichtlich des Waffenfunds in ihrem Haus in … bei der Anhörung beim Bundesamt und im Rahmen der mündlichen Verhandlung bestehen erhebliche Widersprüche. In der Anhörung beim Bundesamt war das klägerische Vorbringen insoweit detailarm und oberflächlich. Die Klägerin führte lediglich aus, dass Feuerwaffen in ihrem Haus gefunden worden seien und ihre Familie sie darüber unterrichtet habe. In der mündlichen Verhandlung hingegen trägt die Klägerin deutlich mehr Details vor, obwohl die Ereignisse Ende 2015 bereits länger zurückliegen als bei der Anhörung beim Bundesamt im November 2017. So trägt die Klägerin in der mündlichen Verhandlung erstmalig vor, dass ihre Stiefmutter sie in Südafrika angerufen und mitgeteilt habe, dass Soldaten Kartons aus dem Haus der Klägerin getragen hätten und die Soldaten sich darüber unterhalten hätten, dass in den Kartons Gewehre seien. Daraufhin habe die Klägerin ihre Freundin, die im Haus auf die Kinder aufpassen sollte, erreichen wollen. Dies sei nicht möglich gewesen. Diese Umstände sind so wesentlich, dass die Klägerin diese bereits bei der Anhörung beim Bundesamt hätte vortragen müssen. Die Ergänzung des Vortrags erweckt für das Gericht den Eindruck, dass die Klägerin nicht von Selbsterlebten berichtet und ihr Verfolgungsschicksal lediglich glaubhafter machen möchte. Nicht nachvollziehbar ist für das Gericht, dass die Klägerin in der Anhörung beim Bundesamt angab, die Polizei habe Waffen gefunden, wohingegen in der mündlichen Verhandlung sie von Soldaten sprach. Der Vortrag der Klägerin auf Nachfrage des Gerichts, im Kongo werde zwischen Polizei und Soldaten nicht unterschieden, ist nicht durchgreifend. In der Anhörung beim Bundesamt gab die Klägerin zudem an, dass ihre Freundin und der Mann aus Ruanda die Waffen im Haus gelagert hätten, wohingegen sie in der mündlichen Verhandlung in Widerspruch dazu vorbrachte, dass ihre Stiefmutter ihr nicht erklären konnte, woher die Waffen seien, und sie ihre Freundin danach fragen wollte, sie aber telefonisch nicht erreicht habe. Auch hat die Klägerin nichts vorgetragen, aus welchem Grund jemand Waffen bei ihr verstecken sollte. Auch hinsichtlich des Vortrags, ihre Familie habe sie informiert, dass sie bei einer Rückkehr wegen dem Waffenfund sofort verhaftet werde, bestehen Widersprüche. Konkrete Drohungen durch die Sicherheitsbehörden hat die Klägerin gerade nicht vorgetragen. Der gesteigerte Vortrag in der mündlichen Verhandlung, die Polizei sei nach ihrer Ausreise immer wieder in ihrem Haus gewesen und Ende 2016 hätte die Polizei ihre Kinder nach ihr gefragt, erweckt den Eindruck, dass die Klägerin die behauptete Bedrohung glaubhafter machen möchte. Gegen drohende Verfolgungshandlungen gegenüber der Klägerin spricht auch, dass sie unbehelligt mit ihrem eigenen Pass von Südafrika nach Kinshasa fliegen konnte und ihr auch in Kinshasa nach eigenen Angaben nichts passiert ist. Auch ist sie von Kinshasa nach Italien nach eigenen Angaben unter ihrem Namen ohne weitere Vorfälle ausgereist.
Auch die behauptete Mitgliedschaft in der UDPS führt nicht zur Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft. Aus dem von der Klägerin im Asylverfahren vorgelegten Parteiausweis geht hervor, dass die Klägerin einfaches Mitglied war („membre ordinaire“). Es ist nichts vorgetragen, dass die von der Klägerin erstmalig im Klageverfahren behauptete (ehrenamtliche) Mitarbeit im Büro der UDPS und ihre Informationstätigkeit über Frauenrechte zu einer aus den einfachen Parteimitgliedern exponierten Stellung der Klägerin innerhalb der UDPS geführt haben könnte. Das Gericht hat schon erhebliche Zweifel an der Glaubhaftigkeit dieses gesteigerten Vortrags. Nicht nachvollziehbar ist, warum die Klägerin diese wesentlichen Umstände nicht bereits bei der Anhörung beim Bundesamt vorgetragen hat. Der Einwand der Klägerin, bei der Anhörung beim Bundesamt sei nicht alles konkret nachgefragt worden, ist nicht nachvollziehbar, da es bei einem solch wesentlichen Umstand gerade im Interesse der Klägerin liegt, diesen frühzeitig und vollumfänglich vorzutragen. Die einfache Mitgliedschaft in einer Oppositionspartei zieht keine Repressionsmaßnahmen nach sich (Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Demokratischen Republik Kongo vom 27.2.2018, S. 11). Im Übrigen ist der Waffenfund nicht glaubhaft (s.o.). Der erstmalig in der mündlichen Verhandlung erfolgte Vortrag, sie habe sich bei der Hilfsorganisation „Éveil de la Femme“ engagiert und sich für Frauenrechte eingesetzt, erweckt den Eindruck, dass dadurch ihre behauptete herausgehobene Stellung gesteigert werden soll.
Auf die Widersprüchlichkeiten im Vortrag der Klägerin, auf die schon das Bundesamt in seinem Bescheid verwiesen hat, wird Bezug genommen (§ 77 Abs. 2 AsylG).
Die Voraussetzungen für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft liegen demnach nicht vor. Da das Gericht der Klägerin keine Vorverfolgung im Heimatland glaubt, ist die Beweiserleichterung des Art. 4 Abs. 4 Qualifikations-RL ohne Relevanz.
b) Die Klägerin hat auch keinen Anspruch auf die hilfsweise begehrte Zuerkennung von subsidiärem Abschiebungsschutz nach § 4 AsylG.
Solcher ist einem Ausländer zuzuerkennen, wenn er stichhaltige Gründe für die Annahme vorgebracht hat, dass ihm in seinem Herkunftsland ein ernsthafter Schaden nach § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 3 AsylG durch einen Akteur im Sinne des § 3c i.V.m. § 4 Abs. 3 AsylG droht. Als ernsthafter Schaden gilt gemäß § 4 Abs. 1 AsylG die Verhängung der Todesstrafe (Nr. 1), Folter oder unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung (Nr. 2) oder eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit einer Zivilperson infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts (Nr. 3). Die §§ 3c bis 3e AsylG gelten entsprechend (§ 4 Abs. 3 AsylG).
Die Klägerin hat, wie oben dargelegt, keine Verfolgung glaubhaft dargelegt. Auch ergeben sich im Hinblick auf die humanitäre Situation keine Hinweise darauf, dass ihr ein ernsthafter Schaden droht.
Die Klägerin hat auch keinen Anspruch auf die Zuerkennung subsidiären Schutzes nach § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AsylG.
Vom Vorliegen eines innerstaatlichen bewaffneten Konflikts ist auszugehen, wenn die regulären Streitkräfte eines Staates auf eine oder mehrere bewaffneten Gruppen treffen oder wenn zwei oder mehrere bewaffnete Gruppen aufeinandertreffen, ohne dass dieser Konflikt als bewaffneter Konflikt, der keinen internationalen Charakter aufweist, im Sinne des humanitären Völkerrechts eingestuft zu werden braucht und ohne dass die Intensität der bewaffneten Auseinandersetzungen, der Organisationsgrad der vorhandenen bewaffneten Streitkräfte oder die Dauer des Konflikts Gegenstand einer anderen Beurteilung als der des im betreffenden Gebiet herrschenden Grads an Gewalt ist (EuGH, U.v. 30.1.2014 – C-285/12- Diakité).
Dabei ist zu überprüfen, ob sich die von einem bewaffneten Konflikt für eine Vielzahl von Zivilpersonen ausgehende – und damit allgemeine – Gefahr in der Person des Klägers so verdichtet hat, dass sie eine erhebliche individuelle Gefahr i.S.v. § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AsylG darstellt. Eine allgemeine Gefahr kann sich insbesondere durch individuelle gefahrerhöhende Umstände zuspitzen. Solche Umstände können sich auch aus einer Gruppenzugehörigkeit ergeben. Der den bestehenden bewaffneten Konflikt kennzeichnende Grad willkürlicher Gewalt muss ein so hohes Niveau erreichen, dass stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, eine Zivilperson würde bei Rückkehr in das betreffende Land oder die betreffende Region allein durch ihre Anwesenheit in diesem Gebiet tatsächlich Gefahr laufen, einer solchen Bedrohung ausgesetzt zu sein (vgl. EuGH, U.v. 17.2.2009 – Elgafaji, C-465/07 – Slg. 2009, I-921).
Bezüglich der Gefahrendichte ist zunächst auf die jeweilige Herkunftsregion abzustellen, in die ein Kläger typischerweise zurückkehren wird (BVerwG, U.v. 14.7.2009 -10 C 9/08 – BVerwGE 134, 188). Die Klägerin hat sich nach eigenen Angaben in … bzw. kurz vor ihrer Ausreise in Kinshasa aufgehalten. Es kann daher dahingestellt bleiben, ob in anderen Labdesteilen, insbesondere im Ost-Kongo, ein bewaffneter Konflikt in diesem Sinn herrscht, denn ein solcher erstreckt sich nicht auf den Westen und insbesondere nicht auf die Hauptstadt Kinshasa.
c) Der Abschiebung der Klägerin steht auch kein nationales Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 AufenthG entgegen.
Ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 AufenthG liegt nicht vor. Eine Abschiebung ist gemäß § 60 Abs. 5 AufenthG unzulässig, wenn sich dies aus der Anwendung der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) ergibt. Gemäß Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung unterworfen werden. Wann eine „unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung“ vorliegt, hängt vom Einzelfall ab. Eine Schlechtbehandlung einschließlich Bestrafung muss jedenfalls ein Minimum an Schwere erreichen, um in den Schutzbereich des Art. 3 EMRK zu fallen. Abstrakt formuliert sind unter einer menschenrechtswidrigen Schlechtbehandlung Maßnahmen zu verstehen, mit denen unter Missachtung der Menschenwürde absichtlich schwere psychische oder physische Leiden zugefügt werden und mit denen nach Art und Ausmaß besonders schwer und krass gegen Menschenrechte verstoßen wird (Bergmann/Dienelt, Ausländerrecht, 12. Aufl. 2018, § 60 AufenthG Rn. 35 f.). Es müssen konkrete Anhaltspunkte oder stichhaltige Gründe dafür glaubhaft gemacht werden, dass der Ausländer im Fall seiner Abschiebung einem echten Risiko oder der ernsthaften Gefahr einer Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung ausgesetzt wäre. Dabei sind lediglich zielstaatsbezogene Abschiebungshindernisse zu prüfen. Abschiebungsschutz nach § 60 Abs. 5 AufenthG kommt nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (U.v. 13.6.2013 – 10 C 13/12, juris, Rn. 24) auch dann in Frage, wenn die umschriebenen Gefahren nicht durch den Staat oder eine staatsähnliche Organisation drohen oder dem Staat zuzurechnen sind (BVerwG, U.v. 13.6.2013 – 10 C 13/12, juris, Rn. 24).
Diese Voraussetzungen liegen mangels erkennbarer Verfolgung der Klägerin nicht vor.
Eine unmenschliche Behandlung droht der Klägerin auch nicht aufgrund der schwierigen Lebensbedingungen in der DR Kongo. Unzureichende wirtschaftliche Verhältnisse im Herkunftsland können in Ausnahmefällen, in denen die schlechten humanitären Verhältnisse eine konkrete Gefahr für Leib oder Leben des Asylbewerbers darstellen, ein Abschiebungsverbot in diesem Sinn begründen. In ganz außergewöhnlichen Fällen können auch (schlechte) humanitäre Verhältnisse Art. 3 EMRK verletzen, wenn die humanitären Gründe gegen die Ausweisung „zwingend sind“. Dies gilt in den Fällen, in denen die schlechten Bedingungen überwiegend auf die Armut oder die fehlenden staatlichen Mittel, um mit Naturereignissen umzugehen, zurückzuführen sind. Wenn jedoch die Aktionen von Konfliktparteien zum Zusammenbruch der sozialen, politischen und wirtschaftlichen Infrastruktur führen, ist zu berücksichtigen, ob es den Betroffenen gelingt, die elementaren Bedürfnisse, wie Nahrung, Hygiene und Unterkunft zu befriedigen (EGMR U.v. 28.6.2011 – 8319/07 – Sufi und Elmi/Vereinigtes Königreich – NVwZ 2012, 681 ff.; EGMR U.v. 27.5.2008 – 26565/05 -N/Vereinigtes Königreich; BVerwG U.v. 31.1.2013 – 10 C 15/12 – juris). Unter Berücksichtigung sämtlicher Gegebenheiten des Einzelfalls ist von einem sehr hohen Niveau der Gefährdung auszugehen (BayVGH, U.v. 21.10.2014 – 13a B 14.30285 -juris).
Es ist davon auszugehen, dass die Klägerin ihren Lebensunterhalt durch eigene Arbeit sowie durch Unterstützung ihrer Großfamilie sichern kann. Die Klägerin ist eine Frau von gehobenem Bildungsniveau. Nach eigenen Angaben hat sie Anglistik und afrikanische Kultur studiert und in ihrem Heimatland als Lehrerin bzw. Verkäuferin gearbeitet. Es ist nicht zu erkennen, warum die Klägerin auch mit ihren vorgetragenen Erkrankungen nach einer Rückkehr ihre Existenz nicht sichern können sollte. Den vorgelegten Attesten kann nicht entnommen werden, dass die Klägerin nicht arbeitsfähig ist, zumal die Klägerin nach eigenen Angaben seit ca. 25 Jahren an Diabetes leidet und trotz der Erkrankung in ihrem Heimatland arbeiten konnte. Nach ihren Angaben in der mündlichen Verhandlung leben ihre Stiefmutter und die beiden Kinder in Kinshasa. Ebenso lebt die Großfamilie noch in ihrem Heimatland. Im Übrigen glaubt das Gericht der Klägerin nicht, dass derzeit ihr Ehemann nicht mehr in der Lage sein soll, sie irgendwie finanziell zu unterstützen, da er nach dem Vortrag der Klägerin Ende 2015 ihre Flucht (ca. 6.000 US $) und ihre medizinische Behandlung in Südafrika mit monatlichen Überweisungen in nicht geringer Höhe finanziert hat.
d) Der Abschiebung der Klägerin steht kein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 7 AufenthG entgegen.
Nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG soll von der Abschiebung eines Ausländers in einen anderen Staat abgesehen werden, wenn dort für diesen eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht. Gefahren, denen die Bevölkerung oder die Bevölkerungsgruppe, der der Ausländer angehört, allgemein ausgesetzt ist, sind bei Anordnungen nach § 60a Abs. 1 Satz 1 AufenthG zu berücksichtigen.
Individuelle nur der Klägerin drohende Gefahren liegen nicht vor. Das Vorbringen hinsichtlich einer Verfolgung ist nicht glaubhaft (s.o.).
Ein Abschiebungsverbot folgt auch nicht aus der bestehenden Diabetes-Erkrankung der Klägerin. Ein krankheitsbedingtes Abschiebungsverbot setzt voraus, dass die Klägerin an einer lebensbedrohlichen oder schwerwiegenden Krankheit leidet, die sich durch die Abschiebung wesentlich verschlechtern würde (§ 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG).
Dies ist vorliegend nicht zu erkennen. Der Klägerin leidet zwar an Diabetes mellitus. Allerdings hat die Klägerin die Erkrankung bereits seit ca. 25 Jahren. Die Behandlung begann sie 1992 in der DR Kongo und die Klägerin wurde dort mit Medikamenten behandelt. Zwar ging die Klägerin ab 2013 immer wieder zur Stabilisierung des Zuckerwertes zur Behandlung nach Südafrika, da die Stabilisierung des Zuckerwertes in ihrem Heimatland schwierig gewesen sei. Ihren eigenen Angaben kann aber nicht entnommen werden, dass die Einstellung ihrer Werte in der Demokratischen Republik schlechthin unmöglich war und die dortige Behandlung zu einer lebensbedrohlichen Verschlechterung ihres Gesundheitszustands geführt hat. Zudem hat die Klägerin über 20 Jahre mit ihrer Erkrankung in ihrem Heimatland leben können, ohne dass lebensbedrohliche Zustände vorgetragen worden noch ersichtlich waren.
Das Gericht verkennt nicht, dass es sich bei der vorliegenden Erkrankung um eine chronische Erkrankung mit einer lebenslangen Behandlungsbedürftigkeit handelt. Allerdings muss glaubhaft gemacht werden, dass diese bei einer Rückkehr zu einer lebensbedrohlichen Verschlechterung führen würde. Zwar enthält das vorgelegte Attest der Diabetespraxis in der …straße vom … Juli 2018 die Angabe, dass bei Abbruch der Therapie mit einer raschen Entgleisung der Zuckerstoffwechsellage zu rechnen sei, und einerseits akut zum Tode führen könnte, andererseits mit großer Wahrscheinlichkeit im Laufe von Jahren u.a. schwere Organschäden mit sich bringen würde. Allerdings tritt die Folge einer Entgleisung des Zuckerwertes nur bei einem Abbruch der Therapie ein. Davon kann aber bei einer Rückkehr der Klägerin in die Demokratische Republik nicht schlechthin ausgegangen werden, da Diabetes mit Bluthochdruck in der DR Kongo behandelbar ist. Insulin ist ohne weiteres erhältlich, wobei drei Viertel aller Kranken zu dem niedrigsten Satz behandelt werden. Spritzen und Insulin kosten dann 0,53 USD. Auch Blutzuckerkontrollen können durchgeführt werden. Gegen Bezahlung stehen in den großen Städten, vorallem in Kinshasa und Lubumbashi, hinreichend ausgestatte private Krankenhäuser und Ärzte zur Verfügung. (vgl. Lagebericht 2018, S. 22; Bericht der deutschen Botschaft vom 3.9.2003). Diese gewährleistete medizinische Versorgung ist ausreichend, mag sie auch verglichen mit der in der Bundesrepublik Deutschland erreichbaren Versorgung nicht gleichwertig sein und zudem auch nicht flächendeckend in der DR Kongo zur Verfügung stehen (§ 60 Abs. 7 S. 3 und 4 AufenthG). Unabhängig davon, ob die Klägerin zwingend zur Stabilisierung des Zuckerstoffwechsels die in Deutschland verordneten Medikamente (Humalog/ Lantus) einnehmen muss oder auch andere ggf. günstigere Medikamente nehmen könnte – hierzu trifft das vorgelegte Attest vom … Juli 2018 keine Aussage -, ist davon auszugehen, dass diese in ihrem Heimatland für die Klägerin verfügbar sind. In Kinshasa gibt es mehrere Apotheken, die gegen Bezahlung binnen weniger Tage so gut wie alle auf dem europäischen Markt zur Verfügung stehenden Medikamente liefern können (Lagebericht 2018, S. 22). Die 45 Jahre alte Klägerin war nach eigener Auskunft vor ihrer Ausreise beruflich tätig (Lehrerin/Verkäuferin). Es ist weder vorgetragen noch erkennbar, dass sie im Fall ihrer Rückkehr nicht wieder arbeiten kann. Zudem bestehen vielfältige familiäre Beziehungen, so dass ihre Existenz auch insoweit als hinreichend gesichert gelten kann. Zudem ist wie oben bereits dargelegt davon auszugehen, dass die Klägerin von ihrem Ehemann zumindest teilweise finanzielle Unterstützung erlangen kann, so wie er bereits ihre Flucht und die medizinische Behandlung in Südafrika in den Jahren 2013, 2014 und 2015 bezahlt hat. Soweit die Klägerin nun erstmals im Klageverfahren vorträgt, ihr Ehemann könne sie nicht mehr finanziell unterstützen, drängt sich dem Gericht der Eindruck auf, dass die Klägerin so glaubhaft machen möchte, dass sie sich die erforderlichen Medikamente zur Behandlung der Diabetes-Erkrankung in ihrem Heimatland nicht leisten kann. Insbesondere greift der Vortrag der Klägerbevollmächtigten, die erforderlichen Medikamente würden in der DR Kongo monatlich mehrere hundert Euro kosten, nicht durch. Das Gericht verkennt dabei nicht, dass die Klägerin für die Kosten der für die Behandlung der Diabetes-Erkrankung erforderlichen Medikamente selbst aufkommen muss. Allerdings kann nicht – wie von der Klägerbevollmächtigten vorgenommen – der in Deutschland zu zahlende Betrag für ein Privatrezept für die jeweiligen Medikamente mit den Kosten in der DR Kongo gleichgesetzt werden. Exemplarisch sei das Medikament Lantus 100 E/ml genannt: laut Klägervortrag kostet dies in Deutschland bei einem Privatrezept 147,06 Euro, in der DR Kongo jedoch ca. 6 Euro (vgl. Bericht der deutschen Botschaft vom 3.9.2003). Bei der bisherigen Medikation (18 Einheiten pro Nacht) würden sich die monatlichen Kosten für dieses Medikament auf ca. 32 Euro belaufen.
Hinsichtlich der vorgetragenen arteriellen Hypertonie ist nichts vorgetragen, dass diese bei einer Rückkehr zu einer wesentlichen Verschlechterung des Gesundheitszustands führen könnte. Das Attest vom … Juli 2018 enthält aber nicht auch nur ansatzweise Aussagen dazu, dass eine Rückkehr der Klägerin insoweit mit erheblichen Gefahren für ihre Gesundheit oder gar Leben verbunden wäre. Das Attest der Allgemeinarztpraxis Dres. … vom … Juli 2017 gibt nur allgemein ohne Darstellung der Krankheit, des Behandlungsverlaufs und genauen Medikation wieder, dass bei einem Absetzen der dringend benötigten Medikamente für die Diabetes und Bluthochdruckerkrankung mit einer erheblichen Verschlechterung des Gesundheitszustands zu rechnen ist. Dies genügt nicht den Anforderungen an ein ärztliches Attest.
Die Klägerin hat auch nicht glaubhaft das Vorliegen einer Anpassungs- bzw. depressiven Störung vorgetragen. Ein damit begründetes Abschiebungsverbot setzt das Vorliegen medizinischpsychologischer Umstände sowie die Existenz eines die Belastungsstörung auslösenden traumatischen Ereignisses voraus.
Hinsichtlich der medizinischpsychologischen Umstände ist zu beachten, dass die Diagnose einer posttraumatischen Belastungsstörung bzw. depressiven Störung für sich gesehen nach der seit dem 17. März 2016 geltenden Fassung des § 60 Abs. 7 AufenthG nicht den Tatbestand eines Abschiebungsverbots begründet. Eine posttraumatische Belastungsstörung bzw. depressive Störung ist als solche weder lebensbedrohlich noch eine schwerwiegende Erkrankung, die sich durch die Abschiebung wesentlich verschlechtern würde (§ 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG). In Fällen einer posttraumatischen Belastungsstörung ist die Abschiebung regelmäßig möglich, es sei denn, die Abschiebung führt zu einer wesentlichen Gesundheitsgefährdung bis hin zu einer Selbstgefährdung (vgl. die Begründung zur Gesetzesänderung in BT-Drs. 18/7538, S. 18). Auch die zusätzlich gestellte Diagnose einer zugleich vorliegenden Angststörung begründet als solche noch kein Abschiebungsverbot.
Unabhängig von den medizinischpsychologischen Voraussetzungen muss das Gericht außerdem vom Vorliegen eines traumatisierenden Erlebnis/Ereignis als Auslöser der Belastungsstörung überzeugt sein. Ein traumatisches Ereignis/Erlebnis ist nämlich zwingende Voraussetzung für die Entwicklung einer posttraumatischen Belastungsstörung. Dass das behauptete traumatisierende Ereignis tatsächlich stattgefunden hat, muss gegenüber dem Tatrichter und nicht gegenüber dem ärztlichen oder psychotherapeutischen Gutachter/Befunderheber nachgewiesen bzw. beachtlich wahrscheinlich gemacht werden. Der objektive Ereignisaspekt ist nicht Gegenstand der gutachterlichen ärztlichen/psychotherapeutischen Untersuchung. Allein mit psychiatrischpsychotherapeutischen Mitteln kann nicht sicher darauf geschlossen werden, ob tatsächlich in der Vorgeschichte ein Ereignis vorlag und wie dieses geartet war. Vielmehr unterliegen die Angaben des Asylbewerbers zu der die behauptete traumatische Belastungsstörung auslösenden, ein Abschiebungsverbot im Sinn von § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG begründenden Vorgeschichte der Beweis- und Tatsachenwürdigung des Gerichts (BayVGH v. 17.10.2012, Az. 9 ZB 10.30390, m.w.N.).
Gemessen daran, liegen die Voraussetzungen des § 60 Abs. 7 AufenthG aufgrund der vorgebrachten psychischen Erkrankungen der Klägerin nicht vor.
Unabhängig von den medizinischpsychologischen Fachfragen im Zusammenhang mit § 60 Abs. 7 AufenthG hat das Gericht aus dem gesamten Vorbringen der Klägerin nicht die Überzeugung der Existenz eines traumaauslösenden Erlebnis/Ereignis gewonnen. Der Vortrag der Klägerin hinsichtlich der Ereignisse vor ihrer Ausreise ist aus den oben genannten Gründen nicht glaubhaft.
Aus diesem Grund – und nicht aus medizinischen Gründen, auf die sich das Gericht mangels hinreichender Sachkunde ohne Zuhilfenahme medizinischen Sachverstandes zur Widerlegung der vorgelegten ärztlichen Befunde nicht berufen könnte – sieht das Gericht hinsichtlich der depressiven Störung verbunden mit einer Angststörung das erst am 12. Juli 2018 im Klageverfahren vorgelegte Attest von Dr. med. S. vom … Juli 2018 als widerlegt an. Der Arzt gibt im Attest lediglich ungeprüft wieder, dass die Klägerin in ihrem Heimatland durch die Regierung bedroht worden sei. Mit dem Wegfall des nicht glaubhaften traumatisierenden Ereignisses ist den vorgelegten medizinischen Befunden die tatsächliche Basis entzogen. Zudem fehlen im Attest Angaben zum genauen Krankheitsbild und Krankheitsverlauf (wann Erstvorstellung? welche Medikation bisher?). Die Angaben im Attest legen es nahe, dass sich die Klägerin erstmals im Sommer 2018 hinsichtlich ihrer vorgetragenen psychischen Erkrankungen in fachärztliche Behandlung begeben hat und damit fast drei Jahre nach den angeblich traumatisierenden Ereignissen Ende 2015. Dem im Asylverfahren vorgelegten Attest der Allgemeinarztpraxis Dres. … vom … September 2016 kann lediglich die Diagnose „depressive Stimmungsschwankungen“ entnommen werden; weitergehende Ausführungen (Befundgrundlage/ etwaiger Behandlungsbeginn/ Medikation) fehlen gänzlich. Dieses Attest genügt daher nicht den Mindestanforderungen an ein ärztliches Attest.
e) Die nach Maßgabe der § 34 Abs. 1, § 36 Abs. 1 AsylG i.V.m. § 59 AufenthG erlassene Abschiebungsandrohung in die DR Kongo ist in rechtlicher Hinsicht gleichfalls nicht zu beanstanden. Die Klägerin besitzt keinen Aufenthaltstitel und ist auch nicht als Asylberechtigte anerkannt. Nach § 59 Abs. 3 Satz 2 AufenthG zu bezeichnende Staaten, in die eine Abschiebung nicht erfolgen darf, sind nicht ersichtlich. Die Ausreisefrist von dreißig Tagen ergibt sich unmittelbar aus § 38 Abs. 1 AsylG.
f) Keinen Bedenken begegnet das gemäß § 11 Abs. 2, Abs. 3 AufenthG festgesetzte Einreise- und Aufenthaltsverbot von dreißig Monaten.
3. Die Klage war nach alledem mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung stützt sich auf § 167 Abs. 2 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. ZPO